Magazin . Das Leben | Mama | Schwangerschaft
Kollagen für deinen Glow – gehypter Trend oder funktioniert das wirklich?
Kollagen als Drink, Pulver oder Shot steht mittlerweile gefühlt auf jedem 2. Küchentresen. Aber kann man sich wirklich etwas in einen Shake rühren, das der Körper dann effektiv in Struktur, Bindegewebe und deine Haut einbaut? Wir gehen der Frage auf den Grund und erklären, was dran ist am Kollagen als Nahrungsergänzung für straffe Haut, kräftige Gelenke und geschmeidige Faszien: Kann das was – oder ist das alles Scam?
VON Kareen Dannhauer


Was ist Kollagen – und was passiert, wenn es weniger wird?
Kollagen ist das häufigste Protein im menschlichen Körper, es macht rund 30 % aller Proteine in unserem Körper aus. Es ist das wichtigste Strukturprotein und bildet damit das physiologische Grundgerüst für Haut, Bindegewebe, Knorpel, Sehnen und Knochen. Kollagen hält das Gewebe elastisch und zugleich belastbar. Ab etwa Mitte 20 sinkt die körpereigene Kollagenproduktion, ab 40 beschleunigt sich dieser Rückgang und wird dann langsam sicht- und spürbar. Die Haut verliert an Elastizität, sie wird dünner, Falten werden tiefer. Das Bindegewebe wird weicher, weniger tragfähig und elastisch, manche Frauen merken das am Knackigkeitsfaktor der Oberschenkel, andere an der Stabilität des Beckenbodens.
Gelenke werden empfindlicher und weniger belastbar, auch Verletzungen heilen nicht mehr so schnell wie gewohnt, weil Kollagen ein wichtiger Bestandteil verschiedener Reparaturprozesse ist. Hormonelle Faktoren, insbesondere der sinkender Östrogenspiegel ab Mitte 30, beschleunigen den Kollagenabbau und wirken sich ungünstig auf die Kollagensynthese, also die Neubildung aus. Und ab 50 geht das dann richtig rasant: Innerhalb der ersten 5 postmenopausalen Jahre verliert die Haut von Frauen bis zu 30 % ihres Kollagengehalts.
Kollagen oral – bringt das wirklich was?
Mit dem richtigen Kollagen: ja. Die richtigen Kollagenprodukte enthalten keine unverdaulichen Faserproteine mehr, sondern hydrolysiertes Kollagen – also aufgespaltene Peptide. Diese werden im Dünndarm aufgenommen und wirken im Körper als Signalmoleküle: Sie regen Fibroblasten in der Haut und Knorpelzellen in den Gelenken an zur Neubildung von körpereigenem Kollagen an. Diese Erkenntnis aus zahlreichen neuen Studien stellt einen wirklichen Paradigmenwechsel dar: Anders als früher angenommen (und immer noch sehr verbreitet unzutreffend aus alten Quellen abgeschrieben), setzen diese Kollagenpeptide also einen effektiven biologischen Impuls zum Aufbau und zur Regeneration des Kollagens in den entsprechenden Geweben. Diese Peptide verbleiben dabei bis zu 96 Stunden im Blutkreislauf und werden gezielt in Haut, Knorpel und Bindegewebe eingebaut.
Kollagen Typ 1, 2 oder 3?
Es gibt unterschiedliche Kollagentypen, mit verschiedenen Funktionen im Körper:
Typ I: der häufigste Kollagentyp, strukturbildend für Haut, Knochen, Sehnen, Bänder – wichtig für Festigkeit und Elastizität.
Typ II: kommt vor allem im Knorpelgewebe vor
Typ III: feinfasriges Kollagen in Haut, Gefäßen und Organen, dies sorgt für Geschmeidigkeit und Durchblutung feiner Gewebe.
Unser Produkt Shine enthält Solugel®, ein hochwertiges hydrolysiertes Kollagen aus Weidehaltung mit überwiegendem Anteil an Typ I und Typ III. Die Hydrolyse sorgt für eine optimale Bioverfügbarkeit: Die Peptide werden gezielt aufgenommen und entfalten ihre Wirkung dort, wo sie gebraucht werden. Es wirkt strukturbildend, regenerativ und antiinflammatorisch.
Obwohl Solugel® kein typischer Typ-II-Rohstoff ist, liefert es klinisch relevante Effekte bei Gelenkbeschwerden, gerade bei Arthrose im Frühstadium und bei überlasteten Gelenken (z. B. bei sportlichen Frauen 40+, s. unten in den Quellen).
Solugel enthält besonders kleine bioaktive Peptide, die im Darm aufgenommen und über den Blutkreislauf ins Gelenk transportiert werden. Dort stimulieren sie Chondrozyten (Knorpelzellen) zur vermehrten endogenen Synthese von extrazellulärer Matrix, insbesondere Proteoglykanen und Typ-II-Kollagen. Zusätzlich wirkt es antiinflammatorisch durch verminderte Expression von MMPs (Matrix-Metalloproteinasen), die bei Arthrose den Knorpelabbau beschleunigen.
Kollagen für deine Haut
Kollagenpeptide wirken also wie ein molekulares Upgrade: Sie stimulieren die Fibroblasten direkt in deiner Dermis – also genau dort, wo Kollagen gebildet wird. Diese Zellen erhalten durch die Peptide das Signal: „Bitte körpereigenes Kollagen bauen!“ Dadurch steigt auch die Hyaloronproduktion, die Haut bindet wieder mehr Feuchtigkeit und wirkt praller. Die Kollagenmatrix wird dichter, strukturierter – Fältchen wirken weicher. Die Elastizität verbessert sich nachweislich – in der Dermatologie der sogenannte „Snap-Back-Effekt“. In Studien war dieser Effekt oft schon nach 6–8 Wochen mess- und sichtbar: Der Teint wirkt frischer, glatter, klarer. Und das Beste: Der Glow kommt nicht von außen – sondern von innen.
Kollagen und Gelenke: Nicht nur für den Glow …
Kollagen ist nicht nur ein Beauty-Thema, sondern essenziell für Beweglichkeit, Heilung und Regeneration. In der Perimenopause erleben viele Frauen erste Beschwerden an Gelenken und Sehnen: Ein Tag in einst geliebten Highheels funktioniert nur noch um den Preis schmerzender Knie oder wird durch schmerzhafte Arthrose in den Großzehengrundgelenken gänzlich unmöglich, beim Yoga knackt und knirscht es plötzlich überall und wenn es mal intensivere Belastungen durch Sport oder Alltag gibt, schmerzt noch Tage später die Schulter. Der Grund ist häufig nicht Überlastung, sondern der schleichende Umbau: Die gelenkschützende Knorpelschicht verliert an Dichte, die Gelenkschmiere wird dünner, das Gewebe entzündet sich leichter. Studien zeigen, dass Kollagenpeptide auch die Knorpelmatrix schützen und regenerieren können.
Eine randomisierte Studie mit Athletinnen zeigte z. B. eine deutliche Reduktion von Gelenkschmerzen bei täglicher Einnahme von 10 g Kollagenhydrolysat über 24 Wochen. Auch bei degenerativen Gelenkbeschwerden, z. B. Arthrose, hilft Kollagen für eine verbesserte Mobilität und Schmerzreduktion.
Muskelmasse erhalten: auch eine Frage der Körperzusammensetzung
Ab dem 40. Lebensjahr verliert der Körper pro Dekade bis zu 8 % Muskelmasse – wenn nichts dagegen unternommen wird. Dieser altersbedingte Verlust betrifft nicht nur Kraft und Beweglichkeit, sondern verändert auch die gesamte Stoffwechselbalance: weniger Muskelmasse bedeutet geringeren Grundumsatz, höhere Insulinresistenz, weniger Stabilität im Alltag. Eine gute Versorgung mit Aminosäuren und Kollagenpeptiden kann helfen, dem vorzubeugen – insbesondere in Kombination mit gezieltem Krafttraining.
Warum Shine?
Shine enthält klinisch untersuchtes Kollagenhydrolysat (Solugel®) aus nachhaltiger Weidehaltung. Das Pulver ist geschmacksneutral, löst sich perfekt in heißen und kalten Getränken und enthält zusätzlich eine Spur MCT-Kokosnuss – als feine, leckere Prise Magie für deinen Glow. Perfekt integrierbar in die Morgenroutine – ob im Kaffee, Matcha oder Smoothie.
Die Kokos-MCTs (mittelkettige Triglyceride) sind nicht nur schnell verfügbare, insulin-neutrale Energieträger, sie unterstützen aktiv die Gesundheit der Darmschleimhaut. In Tiermodellen und vereinzelten Humanstudien konnte gezeigt werden, dass MCTs entzündliche Zytokine (z. B. TNF-α) im Darm senken und die Schleimhautheilung nach Reizungen beschleunigen können. Das stärkt die Barrierefunktion des Darms und wirkt dem sogenannten „Leaky Gut“ entgegen. Zudem unterstützen MCT auch dein Mikrobiom – Shine sorgt also nicht nur für den Glow, sondern auch für ein gutes Bauchgefühl.
MCTs verbessern ferner die Aufnahme fettlöslicher Vitamine wie A, D, E und K. Das macht Shine besonders effektiv, wenn du es zum Beispiel gemeinsam mit unserem Mama Multi einnimmst, und du sonst nicht frühstückst (etwa weil du intermittierend fastest – oder auch einfach morgens keine Zeit hast für komplizierte Routinen).
Dosierung: Wie viel ist sinnvoll?
Die meisten Studien arbeiten mit Tagesdosen zwischen 2,5 g und 10 g. Für Haut und Gelenke werden in der Regel 5–10 g Kollagenhydrolysat täglich empfohlen – oft kombiniert mit Vitamin C. Unsere empfohlene Tagesportion von 10 g in Shine entspricht exakt dieser wirksam untersuchten Menge und lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren.
… und gibt’s das auch in vegan?
Tatsächlich gibt es bislang kein echtes „veganes Kollagen“. Pflanzliche Produkte können lediglich bestimmte Aminosäuren (wie Glycin, Prolin oder Lysin) oder Cofaktoren liefern, die die natürliche Kollagenbildung unterstützen. Diese wirken eher wie ein Baukastensystem, nicht wie strukturähnliche Ersatzstoffe mit der zentralen signalmolekularen Wirkung auf die Fibroblasten. Die Bezeichnung „veganes Kollagen“ ist daher aus wissenschaftlicher Sicht irreführend – sorry to say.
• Eine randomisierte, placebokontrollierte Studie von Proksch et al. (2014) zeigte: 2,5 g Kollagenpeptide täglich über 8 Wochen führten zu signifikant verbesserter Hautelastizität und -feuchtigkeit. (Link)
• Clarke et al. (2008) fanden in einer klinischen Studie: Kollagenhydrolysat verbesserte signifikant Gelenkbeschwerden bei sportlich aktiven Menschen. (Link)
Eine Metaanalyse von Zdzieblik et al. (2021) bestätigt: Hydrolysiertes Kollagen kann Schmerzen bei Kniearthrose lindern und die Funktion verbessern. (Link)
Was sagt die Studienlage?
In den letzten Jahren wurden zahlreiche klinische Studien zu Kollagenpeptiden publiziert, darunter viele qualitativ hochwertige Meta-Analysen. Eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie aus 2014 zeigte z. B. eine signifikante Verbesserung der Hautelastizität nach 8 Wochen bei Frauen zwischen 35 und 55 Jahren. Eine weitere Studie untersuchte Frauen über 50, die 12 Wochen lang Kollagen aus Solugel® einnahmen – mit dem Ergebnis einer deutlich erhöhten Hautdichte und Hydratation. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2021 fasst zusammen, dass oral eingenommenes hydrolysiertes Kollagen – insbesondere in Kombination mit Vitamin C und Zink – zu sichtbaren Verbesserungen in Hautstruktur und -feuchtigkeit führen kann.
Solugel®-Kollagenpeptide aus Weidehaltung plus MCT aus Kokos: Dein tägliches Ritual für mehr Glow, Spannkraft und innere Stärke
29,90€*
Quellen
Bolke, L., Schlippe, G., Gerß, J., & Voss, W. (2019). A collagen supplement improves skin hydration, elasticity, roughness, and density: Results of a randomized, placebo-controlled, blind study. Nutrients, 11(10), 2494.
Al-Atif, H. (2022). Collagen supplements for aging and wrinkles: a paradigm shift in the fields of dermatology and cosmetics. Dermatology practical & conceptual, 12(1), e2022018.
Choi, F. D., Sung, C. T., Juhasz, M. L., & Mesinkovsk, N. A. (2019). Oral collagen supplementation: a systematic review of dermatological applications. J Drugs Dermatol, 18(1), 9-16.
Garcia, T., Dierckx, S., Wu, Y., & Patrizi, M. (2022). The effect of SOLUGEL® collagen peptides intake on skin conditions: a randomized double-blind clinical trial.
Dierckx, S., Patrizi, M., Merino, M., González, S., Mullor, J. L., & Nergiz-Unal, R. (2024). Collagen peptides affect collagen synthesis and the expression of collagen, elastin, and versican genes in cultured human dermal fibroblasts. Frontiers in Medicine, 11, 1397517.
Clark, K. L., Sebastianelli, W., Flechsenhar, K. R., Aukermann, D. F., Meza, F., Millard, R. L., … & Albert, A. (2008). 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain. Current medical research and opinion, 24(5), 1485-1496.
Zdzieblik, D., Oesser, S., Gollhofer, A., & König, D. (2017). Improvement of activity-related knee joint discomfort following supplementation of specific collagen peptides. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 42(6), 588-595.
Khatri, M., Naughton, R. J., Clifford, T., Harper, L. D., & Corr, L. (2021). The effects of collagen peptide supplementation on body composition, collagen synthesis, and recovery from joint injury and exercise: a systematic review. Amino acids, 53(10), 1493-1506.
Jendricke, P., Centner, C., Zdzieblik, D., Gollhofer, A., & König, D. (2019). Specific collagen peptides in combination with resistance training improve body composition and regional muscle strength in premenopausal women: a randomized controlled trial. Nutrients, 11(4), 892.
Magazin . Das Leben | Mama | Papa
Kreatin – Brain Boost oder Bodybuilding?
Hier erfährst du alles über das unterschätzte Molekül für das weibliche Gehirn, mentale Gesundheit und deine Energie
VON Kareen Dannhauer


Kreatin: Adieu Cliché
Die viel verbreitete Assoziation bei Kreatin ist immer noch eine klassisch männlich-leistungssport-orientierte: Wir denken an Bodybuilding und testosterongeladenes Pumpen in der Muckibude. Doch Kreatin ist mehr als ein Supplement fürs Gym und dicke Oberarme. In der Longevity-Forschung wird es zunehmend als neuroprotektiver, zell-energetischer Wirkstoff diskutiert – gerade auch ist das wichtig, wenn wir wichtige Aspekte in der weiblichen reproduktiven Gesundheit ansehen (etwa in der Zeit des Kinderwunsches und der Schwangerschaft) und in herausfordernden Zeiten mental leistungsfähig, kreativ und widerstandsfähig sind – und dies auch bleiben möchten.
Was ist Kreatin eigentlich?
Kreatin ist ein Aminosäure-Derivat, das aus Arginin, Glycin und Methionin gebildet wird. Unser Körper speichert es in Form von Kreatinphosphat – als schnellen Energieträger, vor allem in Muskel- und Nervenzellen. Dort hilft es, Energie bereitzustellen, wenn ATP (unser Zelltreibstoff) gebraucht wird.
Was macht Kreatin im Körper?
Kreatin speichert und liefert Energie in Form von ATP, besonders in Zellen mit hohem Energiebedarf und puffert damit gleichsam Energiemangel ab – und schützt so hochaktive Zellen, wie z. B. die des Gehirns. Der Kreatinstoffwechsel im Gehirn ist zentral für neuronale Kommunikation und Reizweiterleitung, also auch alle Denkprozesse. Ein Mangel kann zu schnellerer mentaler Erschöpfung, Konzentrationsstörungen oder Stimmungstiefs beitragen. Auch PMS-assoziierte Reizbarkeit und kognitive Dysbalancen sind mit niedrigen Kreatinspiegeln assoziiert.
Warum ist das für Frauen besonders wichtig?
Frauen haben biologisch bedingt geringere Kreatinspeicher als Männer, etwa weil sie durch ihre andere Körperzusammensetzung weniger Muskelmasse als Speicher besitzen, zudem sinkt die endogene Synthese durch einen beginnenden Östrogenmangel bereits in der Peri-Menopause. Auch eine pflanzenbasierte Ernährung, häufiger unter Frauen anzutreffen, senkt die Zufuhr durch die Nahrung massiv, Kreatin kommt fast ausnahmslos in Fleisch und Fisch vor. Umso wichtiger ist eine gezielte Supplementierung für Energie, Fokus und kognitive Resilienz. Besonders in stressreichen Phasen oder bei vegetativer Erschöpfung kann Kreatin stabilisierend wirken, mittlerweile gibt es zahlreiche spannende Studien dazu. Auch neurodivergenten Frauen – etwa mit ADHS oder Hochsensibilität – profitieren von Kreatin, es kann helfen, die Reizverarbeitung zu stabilisieren und damit die mentale Resilienz zu stärken und kognitive Erschöpfung abzufedern.
Eine randomisierte kontrollierte Studie von McMorris et al., 2007 mit jungen Frauen zeigte eine verbesserte kognitive Leistung und reduzierte mentale Erschöpfung nach Kreatineinnahme. Eine Übersicht von Rawson & Venezia (2011) stellt fest, dass Kreatin das Arbeitsgedächtnis, die Reaktionszeit und die Stresstoleranz verbessert.
Kreatin bei Schlafentzug
Kreatin ist so potent, dass sogar eine hochdosierte Einzelgabe messbare Effekte auf unser Gehirn hat. Eine Placebo-kontrollierte Studie des Instituts für Neurowissenschaften in Jülich fand, dass eine hohe Einzeldosis Kreatin (0,35 g/kg Körpergewicht, also etwa 25 g bei 70 kg Körpergewicht) während einer 24-stündigen Wachphase für deutlich bessere kognitive Performance sorgte – sowohl bei Verarbeitungsgeschwindigkeit als auch Kurzzeitgedächtnis, messbar per MRT als Stabilisierung des Kreatinphosphat-Spiegels im Gehirn. Kreatin hält das Denken auch also auch in absoluten Stressphasen auf Kurs – und kaum etwas stresst unser Gehirn so sehr, wie Schlafentzug.
Kreatin und Depression
Studien bei depressiven Frauen unter SSRI-Medikation zeigen, dass Kreatin (5 g täglich) die Stimmung deutlich stabilisieren kann. So fanden Lyoo et al. 2012 signifikante Effekte im Hamilton-Depressionsscore. Auch bei Behandlung therapieresistenter Depressionen wird eine Dosis von 3–5 g täglich mit Stimmungsverbesserungen in Zusammenhang gebracht.
Neurodegeneration & kognitives Altern
Neueste Forschung zeigt erstmals, dass Kreatin bei Alzheimer-Patient:innen zur Verringerung von β Amyloiden beitragen kann, vermutlich durch zellschützende Effekte. Darüber hinaus wurden bei Vegetarierinnen kognitive Verbesserungen (IQ, Arbeitsgedächtnis) nach täglich 5 g Kreatin über mehrere Wochen dokumentiert.
Und ja, Muskeln auch!
Neben seinen Effekten auf das Gehirn spielt Kreatin natürlich auch die altbekannte Rolle beim Erhalt der Muskelmasse. Frauen verlieren ab dem 40. Lebensjahr messbar an Muskelkraft und -volumen – mit weitreichenden Folgen für Stabilität, Stoffwechsel, Insulinsensitivität und Körperzusammensetzung. Studien zeigen, dass Kreatin hier – in Kombination mit regelmäßigem Krafttraining – nicht nur Muskelmasse erhält, sondern auch den Ruheumsatz unterstützt und funktionelle Kraft verbessert. Gerade in Lebensphasen mit hormonellem Shift ist das ein wichtiger Baustein, um körperlich wie kognitiv widerstandsfähig zu bleiben.
Kreatin in der Ernährung: Kreatin als klassisches Carninutrient
Wie oben erwähnt, kommt Kreatin fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor – vor allem in rotem Fleisch und Fisch. Pflanzliche Lebensmittel enthalten praktisch kein Kreatin. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, nimmt daher oft weniger als 1 g täglich auf und rutscht damit in eine Unterversorgung. Aber auch viele omnivore Frauen erreichen nicht die Mengen, die für einen Kreatinspiegel sorgen, der in Studien mit positiven Effekten verbunden sind. In Kombination mit dem hormonellen Rückgang der körpereigenen Synthese kann das zu einem suboptimalen Versorgungsstatus führen – und damit zu Energieeinbußen, mentaler Erschöpfung oder Konzentrationsproblemen.
Wie viel Kreatin ist sinnvoll?
In Studien reichen effektive Tagesdosen von 3 bis 10 g Kreatin-Monohydrat, teils auch aufgeteilt in zwei Portionen. Zwei der unten aufgeführten Studien haben mit diesen Dosierungen gearbeitet: (Links einfügen)
3-5 g täglich , Ergebnisse nach 4 Wochen (Roitman et al. 2007)
5 g täglich, Ergebnisse nach 8 Wochen (Lyoo et al. 2012)
5 g täglich, Ergebnisse nach 6 Wochen (Rae et al. 2003)
Eine langfristige, alltagstaugliche und spürbare Supplementierung liegt also etwa bei 3–5 g/Tag.
Die Effekte sind etwa 9 Stunden lang messbar und erreichen ihren Peak nach etwa 4 Stunden.
Bright ist also dein ideales Supplement für den Start in den Tag. Es liefert 3 g mikrofeines Kreatin pro Tagesportion – eine physiologisch wirksame Dosis, die sanft startet und individuell erhöht werden kann. Wer intensiver supplementieren möchte, kann die Menge schrittweise anpassen, idealerweise in Rücksprache mit deiner Ärztin oder Therapeutin.
Bright Brain: Unser Kreatin für dein Gehirn
Bright enthält mikrofeines Kreatin-Monohydrat aus dem patentierten Markenrohstoff Creavitalis®. Es zeichnet sich durch besonders herausragende Löslichkeit und Bioverfügbarkeit aus, so dass es schnell in deinen Zellen landet. Es kann ganz einfach in Wasser, Saft oder Tee eingerührt werden – fast ohne Eigengeschmack. Perfekt für den Fokus am Morgen, vor einem anspruchsvollen Arbeitstag, vor deinem herausfordernden Training oder zur Erholung nach mentaler Erschöpfung.
… und in der Schwangerschaft?
Auch in der Schwangerschaft rückt Kreatin zunehmend in den Fokus der Forschung: Studien deuten darauf hin, dass eine gute Kreatinversorgung das fetale Gehirn vor hypoxischem Stress unter der Geburt schützen und die neuronale Entwicklung fördern kann – mehr dazu lest ihr hier im Artikel Kreatin in der Schwangerschaft
Quellen
Allen PJ. Creatine metabolism and psychiatric disorders: Does creatine supplementation have therapeutic value? Neurosci Biobehav Rev. 2012 May;36(5):1442-62. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.03.005. Epub 2012 Mar 24. PMID: 22465051; PMCID: PMC3340488.
Roitman S, Green T, Osher Y, Karni N, Levine J. Crea%ne monohydrate in resistant depression: a preliminary study. Bipolar Disord. 2007 Nov;9(7):754-8. doi: 10.1111/j.1399-5618.2007.00532.x. PMID: 17988366.
Rae C, Digney AL, McEwan SR, Bates TC. Oral crea%ne monohydrate supplementa%on improves brainperformance: a double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Proc Biol Sci. 2003 Oct 22;270(1529):2147-50. doi: 10.1098/rspb.2003.2492. PMID: 14561278; PMCID: PMC1691485.
Candow DG, Forbes SC, Ostojic SM, Prokopidis K, Stock MS, Harmon KK, Faulkner P. „Heads Up“ for Creatine Supplementation and its Potential Applications for Brain Health and Function. Sports Med. 2023 Dec;53(Suppl1):49-65. doi: 10.1007/s40279-023-01870-9. Epub 2023 Jun 27. Erratum in: Sports Med. 2024 Jan;54(1):235-236. doi: 10.1007/s40279-023-01888-z. PMID: 37368234; PMCID: PMC10721691.
Gordji-Nejad A, Matusch A, Kleed.rfer S, Jayeshkumar Patel H, Drzezga A, Elmenhorst D, Binkofski F, Bauer A. Single dose creatine improves cognitive performance and induces changes in cerebral high energy phosphates during sleep deprivation. Sci Rep. 2024 Feb 28;14(1):4937. doi: 10.1038/s41598-024-54249-9. PMID: 38418482; PMCID: PMC10902318.
Lyoo IK, Yoon S, Kim TS, Hwang J, Kim JE, Won W, Bae S, Renshaw PF. A randomized, double-blind placebocontrolled trial of oral crea%ne monohydrate augmentation for enhanced response to a selective serotonin reuptake inhibitor in women with major depressive disorder. Am J Psychiatry. 2012 Sep;169(9):937-945. doi: 10.1176/appi.ajp.2012.12010009. PMID: 22864465; PMCID: PMC4624319.
Smith AN, Morris JK, Carbuhn AF, Herda TJ, Keller JE, Sullivan DK, Taylor MK. Creatine as a Therapeutic Target in Alzheimer’s Disease. Curr Dev Nutr. 2023 Sep 29;7(11):102011. doi: 10.1016/j.cdnut.2023.102011. PMID: 37881206; PMCID: PMC10594571.
Wenn dein Gehirn großes leisten soll: Bright enthält den Markenrohstoff 100 % Creavitalis®-Kreatinmonohydrat in mikronisierter Qualität – hochrein und besonders gut löslich
25,90€*
Magazin . Das Leben | Familie | Mama
Mood Swings, Mama-Burnout & mentale Achterbahn – was ist hier eigentlich los?
Manchmal fühlt es sich an, als hätte jemand den Regler für Reizbarkeit, Erschöpfung und innere Unruhe hochgedreht – und wir schaffen es einfach nicht, das zu tun, was uns so gut täte, nämlich in unsere 24 h des Tages zumindest etwas Metime für Yoga und Spaziergänge einzutakten, um zwischendurch zumindest einmal kurz die reset-Taste zu drücken: Willkommen in der Rushhour des Lebens.
VON Kareen Dannhauer


Zwischen Care-Arbeit, Deadline und Durchschlafen
Es ist auch alles ganz schön viel: Zwischen 35 und 50 befinden wir uns in einer Phase, die psychisch und körperlich fordernder kaum sein könnte: Job & Kinder, Mutti-Zettel & Mental Load, Liebespaar & Pausenbrot, und in all diese Tasks probieren wir auch noch, die nötige Dosisi Selfcare unterzubringen. Und scheitern mit all diesen Ansprüchen fröhlich vor uns hin. Es ist auch nicht so, dass wir nicht wüssten, dass Pausen und Innehalten wichtig wären – aber wie soll das in den permanenten Spagat auch noch reingestopft werden. Die Rushhour des Lebens ist nicht nur ein eingeführter soziologischer Begriff – es ist tatsächlich auch neurobiologisch messbar, was wir spüren: Erhöhter Cortisolspiegel, zyklusabhängige Schwankungen in der Neurotransmitterbalance, erste Rückgänge von Estradiol und Progesteron ab Mitte dreißig, oft auch eine veränderte Schilddrüsenachse. Kein Wunder also, dass Reizbarkeit, Stimmungstiefs, Grübelschleifen oder emotionale Abstumpfung in dieser Phase häufig auftreten.
Hormone und Neurotransmitter
Dieser hormonelle Wandel zwischen Stillzeit und Perimenopause beginnt allmählich – und oft viel früher, als gedacht. Eben noch in der Blüte deiner Jugend, und nun plötzlich schon Perimenopause? Ernsthaft? Tatsächlich beginnen bereits ab Mitte 30 diese Wandlungsprozesse, erst still im Verborgenen. Dein Zyklus als äußerlich sichtbares und spürbares Ereignis bleibt meist noch eine ganze Weile stabil. Oft werden aber unter der Oberfläche allmählich typische Phänomene spürbar, die du wahrscheinlich erst gar nicht mit diesen allmählichen Umbauprozessen in Verbindung bringst: Symtome von PMS werden intensiver (oder treten erstmals auf), die Schlafqualität sinkt, kleine Trigger führen zu größerer innerer Unruhe, als du es bisher kanntest. Das Gehirn reagiert sensibler auf Stress, Reize und Schlafmangel. Die endokrine Steuerung vieler Neurotransmitter verschiebt sich. Besonders betroffen: Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Das Ergebnis sind Stimmungsschwankungen, innere Leere, Antriebslosigkeit oder das berühmte „Mir ist einfach alles zu viel“. Meh.
Adaptogene: Pflanzenintelligenz für Stressresilienz
Adaptogene nennt man Pflanzenstoffe, die dem Körper helfen, sich an physischen oder emotionalen Stress anzupassen. Anders als klassische Stimulanzien wirken sie aber nicht über kurzfristigen Push (wie etwa Koffein, ebenfalls ein Pflanzenstoff), sondern über eine harmonisierende, stressachsenmodulierende Wirkung. Sie beeinflussen u. a. die HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse), senken Cortisolspitzen, fördern Schlaf und emotionale Flexibilität – ohne müde zu machen oder zu sedieren, aber auch ohne “Kick” mit erhöhtem Arousal und Anxiety, wie etwa Kaffee es tut. Zwei davon sind besonders bekannt und gut untersucht: Ashwagandha und Rhodiola rosea.
• ASHWAGANDHA (Withania somnifera)
Der in vielen klinischen Studien untersuchte Adaptogen-Klassiker senkt Cortisol, verbessert Schlafqualität und wirkt ausgleichend bei Stress, Angst und innerer Unruhe. In Studien zeigten sich positive Effekte bei chronischem Stress, PMS, Wechseljahresbeschwerden und Angststörungen.
• RHODIOLA ROSEA
Der sibirische Rosenwurz wirkt aktivierend, ohne innere Unruhe auszulösen Die Wirkung wird u. a. auf die Modulation des serotonergen Systems zurückgeführt. Studien zeigen: Rhodiola kann Erschöpfung senken, Stimmung stabilisieren und die kognitive Leistungsfähigkeit in stressreichen Situationen verbessern.
Aminosäuren & Neurotransmitter: kleine Moleküle mit großer Wirkung
Aminosäuren sind die zentralen Bausteine für so vieles in unserem Körper – unter anderem sind sie sind die Grundstoffe für unsere Hormone und Neurotransmitter. Aus Tyrosin entsteht Dopamin, das uns motiviert und fokussiert. Aus Tryptophan bildet sich Serotonin, das Stimmung und Schlaf reguliert. Und Glutamin wird zu GABA, dem wichtigsten beruhigenden Botenstoff im Gehirn. Ohne ausreichende Aminosäuren fehlt dem Gehirn buchstäblich das Material, um Balance und Klarheit herzustellen. Deshalb sind eine gute Versorgung und gezielte Ergänzung – gerade in stressreichen Lebensphasen – so entscheidend. Einige Aminosäuren haben sogar direct Neurotransmitter-like Effekte im Gehirn:
• TAURIN wirkt regulierend auf den GABA-Stoffwechsel – GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im ZNS. Das bedeutet: weniger neuronale Übererregung, ruhigere Reizverarbeitung, erholsamerer Schlaf. Taurin unterstützt außerdem die Zellstabilität in Nervenzellen und hat antioxidative Eigenschaften. In Energy-Drinks wird es wegen seiner beruhigenden Effekte auf das ZNS eingesetzt, um die unangenehmen Überstimulations-Effekte großer Dosen Koffein zu regulieren. Taurin wirkt relaxierend auf das Endothel unerer Blutgefäße, es senkt den Blutdruck und die Herzfrequenz.
• TYROSIN ist die Vorstufe für die Katecholamine Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin. Ein niedriger Tyrosinspiegel ist mit geringerem Antrieb, schlechterer Konzentration und erhöhter Stressanfälligkeit assoziiert. Besonders unter Schlafmangel oder mentaler Überlastung kann eine gezielte Tyrosin-Supplementierung kognitive Leistungsfähigkeit und Stimmung stabilisieren – ohne pushenden Effekt wie bei Koffein.
Kreatin
Kreatin, ein Aminosäurenderivat aus Arginin, Glycin und Methionin speichert und liefert unseren Zellen Energie in Form von ATP. Der Kreatinstoffwechsel im Gehirn ist zentral für neuronale Kommunikation und Reizweiterleitung, also auch alle Denkprozesse und mentale Gesundheit. Ein Mangel kann daher zu schnellerer emotionaler Erschöpfung, Konzentrationsstörungen oder Stimmungstiefs beitragen. Auch PMS-assoziierte Reizbarkeit und kognitive Dysbalancen sind mit niedrigen Kreatinspiegeln assoziiert. Einen ausführlichen Artikel zur Wirkung von Kreatin als Brainboost findest du hier. (Link Kreatin – Brain Boost oder Bodybuilding?)
Don’t Fight the Feelings – sanfte Hilfe für emotionale Balance
Unser Produkt “Don’t Fight the Feelings” ist speziell für diese herausfordernden Lebensphasen entwickelt. Es unterstützt als mittelfristige Stärkung der Stressachse und Neurotransmitterbalance.
Ashwagandha, Rhodiola, Taurin und Tyrosin – ein adaptogener Cocktail
Hinweis: Das Produkt ist nicht geeignet in der Schwangerschaft und für voll stillende Frauen.
Quellen
Akhgarjand, C., Asoudeh, F., Bagheri, A., Kalantar, Z., Vahabi, Z., Shab-bidar, S., … & Djafarian, K. (2022). Does Ashwagandha supplementation have a beneficial effect on the management of anxiety and stress? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytotherapy Research, 36(11), 4115-4124.
Pratte, M. A., Nanavati, K. B., Young, V., & Morley, C. P. (2014). An alternative treatment for anxiety: a systematic review of human trial results reported for the Ayurvedic herb ashwagandha (Withaniasomnifera). The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 20(12), 901-908.
Speers, A. B., Cabey, K. A., Soumyanath, A., & Wright, K. M. (2021). Effects of Withania somnifera (Ashwagandha) on stress and the stress-related neuropsychiatric disorders anxiety, depression, and insomnia. Current neuropharmacology, 19(9), 1468-1495.
Cropley, M., Banks, A. P., & Boyle, J. (2015). The effects of Rhodiola rosea L. extract on anxiety, stress, cognition and other mood symptoms. Phytotherapy research, 29(12), 1934-1939.
Anghelescu, I. G., Edwards, D., Seifritz, E., & Kasper, S. (2018). Stress management and the role of Rhodiola rosea: a review. International journal of psychiatry in clinical practice, 22(4), 242-252
Ivanova Stojcheva, E., & Quintela, J. C. (2022). The effectiveness of rhodiola rosea L. Preparations in alleviating various aspects of life-stress symptoms and stress-induced conditions—encouraging clinical evidence. Molecules, 27(12), 3902.
Rae, C., Digney, A. L., McEwan, S. R., & Bates, T. C. (2003). Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance: a double–blind, placebo–controlled, cross–over trial. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 270(1529), 2147-2150.
Neri, D. F., Wiegmann, D., Stanny, R. R., Shappell, S. A., McCardie, A., & McKay, D. L. (1995). The effects of tyrosine on cognitive performance during extended wakefulness. Aviation, space, and environmental medicine, 66(4), 313-319.
Banderet, L. E., & Lieberman, H. R. (1989). Treatment with tyrosine, a neurotransmitter precursor, reduces environmental stress in humans. Brain research bulletin, 22(4), 759-762.
Singh, P., Gollapalli, K., Mangiola, S., Schranner, D., Yusuf, M. A., Chamoli, M., … & Yadav, V. K. (2023). Taurine deficiency as a driver of aging. Science, 380(6649), eabn9257.
Sahakyan NA, Sarkissian JS, Aznauryan AV, Simonyan LYu, Shogeryan SA. Impact of taurin on the variability of the cardial rhytm and morphofunctional changes of the organs of the immune system. Electronic Journal of Natural Sciences. 2017;28(1):50–52.
Avetisyan EA, Petrosyan AA, Khachiyan MS, Saakyan NA, Simonyan LYu, Shogheryan SA. The role of taurine in adaptation of visceral systems under psycho-emotional stress in rats. Journal of evolutinary biochemistry and physiology. 2017;53(1):33–40.
Izquierdo, J. M. (2024). Taurine as a possible therapy for immunosenescence and inflammaging. Cellular & Molecular Immunology, 21(1), 3-5.
Don’t Fight the Feelings – sanfte Hilfe für emotionale Balance
Magazin . Das Leben | Mama | Wochenbett
Frosted NippleBalm: Baby, it’s cold outside
Und so geht es auch allen Naturkosmetik-Produkten, die zu einem hohen Anteil aus Fett bestehen, wie zum Beispiel mein Nipple Balm. Es hat nicht das ganze Jahr über die gleiche Konsistenz. Es ist fester im Winter und weicher im Sommer. Weil wir unsere Rezepturen grundsätzlich eben nicht mit Stabilisatoren oder Emulgatoren aus der Chemieküche pimpen, leben unsere Produkte.
VON Kareen Dannhauer


Das Nipple Balm besteht zu einem Großteil aus Lanolin, gemixt mit etwas Bio-Shea, Bio-Hagebuttenkernöl und Bio-Neroli-Hydrolat. Sonst gar nichts. Purer geht es kaum. Meine bewährte Super-Lieblings-Mische für wunde Brustwarzen, klaro, aber eben auch für einen wunden Babypo oder als Kälteschutz für zarte Bäckchen, sozusagen eine Wind-und-Wetter-Creme, und übrigens auch mein Lieblings-Lippenbalsam.
Das Balm hat einen Schmelzpunkt von etwa 28-29 Grad (auch das ist bei jeder Charge etwas unterschiedlich, es sind eben Naturprodukte). So ist es eingestellt, damit es dann im Hochsommer auch nicht zu flüssig wird.
Alle Salben kämpfen bei Minusgraden draußen (oder in kühlen Räumen, etwa auf der Fensterbank) ein wenig mit der Kälte. Auch mein absolutes Favoriten-Erkältungsbalsam, das Engelwurz-Balsam von Ingeborg Stadelmann, kriegte ich am Wochenende kaum aus der Tube, und mein Lieblings-Deo-Balm Fine (ebenfalls auf Kokosölbasis) braucht nun wirklich den kleinen Holzspatel. Umgekehrt läuft das Weleda Wind- und Wetterbalsam schon bei leicht erhöhter Raumtemperatur fast aus der Tube. Es ist ein schmales Temperaturfenster. Und wir Bio-Produzenten kochen alle mit dem gleichen Wasser.
Wir haben uns bei der Nipple Balm-Verpackung für einen cleveren Airless-Spender entschieden, aus mehreren Gründen. Erstens: Es kommt nach der Abfüllung – anders als bei herkömmlichen Pumpspendern – keine Luft mehr an das Balm, es wird nämlich vom innenliegenden Stempel nach oben in Richtung Auslass geschoben. Es ist so vor Oxydation und vor dem Austrocknen geschützt. Zweitens kann das Balm entnommen werden, ohne dass Finger an das Produkt kommen. Selbst gewaschene Hände sind niemals steril, und Hautbakterien können sich in Cremes rasant vermehren, wenn sie in herkömmliche Tiegel oder auch Tuben abgefüllt werden. Üblicherweise werden deshalb entweder Konservierungsmittel eingesetzt oder nur eine Haltbarkeit von nur wenigen Wochen ausgelobt. Mit dem Airless-Spender können wir in diesem Produkt vollkommen auf alle Konservierungsstoffe verzichten, die Dein Baby eben auch nicht mitessen soll. So bleibt das Nipple Balm immer hygienisch einwandfrei.
Drittens lassen sich diese Spender easy mit einer Hand bedienen, was enorm praktisch ist, wenn gerade ein Baby im Arm eingeschlummert ist. Auch dann, wenn die Kappe nicht sofort wieder draufkommt, weil sie gerade irgendwo unterm Stillkissen begraben wurde, läuft nix aus und nix krümelt rein.
Im Winter allerdings kämpft dieser special-Spender ein bisschen mit der höheren Festigkeit des Nipple Balms. Was zur Folge hat, dass man zu Beginn, bei der Inbetriebnahme des frischen Balms, tatsächlich manchmal ganz schön oft pumpen muss, bis endlich etwas kommt.
Manchmal auch über 20-mal – was einen möglicherweise erstmal glauben lässt, der Spender sei kaputt. Bitte jetzt nicht genervt aufgeben:
Einfach weitermachen, irgendwann knistert es dann leise und das Balm hat es bis nach ganz oben geschafft. Mit dem Wissen „Warum“, könnte es auch glatt als Qualitätsmerkmal durchgehen – und ein Verständnis wecken für echte Naturprodukte, die eben nicht standardisiert sind und sein können, wie es konventionelle Produkte sind. So duftet das Hagebuttenkernöl eben manchmal fruchtig-süß, manchmal etwas säuerlicher.
Ist in der einen Charge eher rosa, in der nächsten orange. Soll so.
Alles das bedeutet es, was into life ausmacht. Natur, bio, Lebendigkeit. Und da pumpen wir gern erstmal ein bisschen öfter, oder?
(Trick-17-Hack für ganz zähes Balm, oder für die, die auf häufiges Pumpen keine Lust haben: Unten am Boden des Spenders befindet sich ein winziges Loch. Mit einer aufgebogenen Büroklammer kann man dort von unten mithelfen, während des Pumpens den Stempel zügiger nach oben zu drücken. Geht dann etwas schneller …)
Auf der Basis von hochreinem Lanolin lindert es schmerzende, vom Stillen strapazierte Brustwarzen. Naturkosmetikzertifiziert und Hebammen-made.
mit Lanolin, Shea und Nerolihydrolat
17,90€*
Magazin . Das Leben | Geburt | Mama | Schwangerschaft
Das Mikrobiom in Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit
Vaginale Gesundheit – wichtig für eine unbeschwerte Schwangerschaft
Eine gesunde Flora spielt in der Schwangerschaft eine wichtige Rolle: Lactobazillen, die Wasserstoffperoxid produzieren, schützen dein vaginales Mikrobiom, etwa vor Bakterien, die das Risiko für bestimmte Schwangerschaftsrisiken (vor allem vorzeitige Wehen oder eine Cervixinsuffizienz) erhöhen. Aber auch deine Darmflora ist wichtig: Aus ihr speist sich nämlich nicht nur das vaginale Mikrobiom, auch die Besiedelung der Brust und damit deiner Muttermilch wird tatsächlich von deiner Darmflora gesteuert. Und nicht zuletzt sind beide Mikrobiota diejenigen, mit denen dein Baby zu allererst in Kontakt kommt …
VON Kareen Dannhauer


Laktobazillen produzieren also nicht nur Milchsäure, einige von ihnen auch Wasserstoffperoxid (H2O2). Dieses reguliert den pH-Wert und wirkt spezifisch als Bakteriozin, macht also die Umgebung ungastlicher für unerwünschte Bakterien und Pilze, sogar für Papilloma-Viren. Es schützt die Vagina vor Fremdbesiedlungen etwa mit dem unerwünschten Gardnerella vaginalis und anderen Keimen, die im Kontext „Frühgeburtlichkeit“ (vorzeitige Wehen und frühe, vorzeitige Blasensprünge) eine Rolle spielen können. Auch bei Besiedelung mit B-Streptokokken eine Dysbalance deiner Flora einen ungünstigen Einfluss auf das Keimspektrum nehmen. Die orale Einnahme von Laktobazillen, also präziser, für die Frauengesundheit designter Probiotika, kann die vaginale Flora günstig beeinflussen: Sie landen zunächst im Magen-Darm-Trakt, der unser größtes Mikrofilm beherbergt. Und Darmbakterien sind direkt an der Zusammensetzung der Vaginalflora beteiligt.
Mikrobentransfer unter der Geburt
Während einer vaginalen Geburt kommt das Baby zum allerersten Mal mit Bakterien direkt in Berührung – und es sind die aus der Vagina seiner Mutter und die aus ihrem Darm. Was zunächst vielleicht etwas eklig klingt, soll genau so sein: Deine Bakterien sind das Beste, was dein Baby auf diesem Weg bekommen kann.
Muttermilch – ein probiotischer Drink für Dein Baby
Früher hat man angenommen, Muttermilch sei steril, heute weiß man, dass dies ganz und gar nicht der Fall ist. Vor einigen Jahren hat man den so genannten entero-mammary-pathway entdeckt. Darmbakterien gelangen während der Schwangerschaft offenbar mit Hilfe so genannter dendritischer Zellen über die Blutbahn in das Drüsengewebe der Brust und besiedeln es.
Muttermilch ist ein in vielerlei Hinsicht hochkomplexes, für das Baby perfekt zusammengestelltes Nahrungsmittel mit allen erdenklichen Nährstoffen, aber auch unzähligen weiteren zellulären und epigenetischen Informationen. In einem Milliliter Milch sind neben mehr als 10 Millionen Bakterien, vor allem aus den Laktobazillen- und Bifidobakterien-Familien, auch Humane Milch-Oligosaccharide (HMO) enthalten, die die Bakterien „füttern“. Diese machen Muttermilch zu einem prä- und probiotischen Drink und leisten einen wesentlichen Beitrag zur physiologischen Besiedelung des Babydarms, quasi das bessere und maßgeschneiderte „Actimel“ für jedes Baby.
Das Busen-Mikrobiom und Infektionen
Diese „guten Bakterien“ sind nicht nur ideal für dein Baby, bestimmte Keimstämme (etwa L. salivarius und L. gasseri) können wirksam gegen eine Brustentzündung (Mastitis) sein und ihnen vorbeugen. Studien* haben gezeigt, dass sich die Beschwerden von Frauen mit so genannter „subakuter Mastistis“ deutlich verbesserte, wenn sie diese Bakterien mindestens drei Wochen lang einnahmen, während sich bei den Placebo-Gruppen nichts Wesentliches änderte.
Vaginal Seeding
Wird ein Baby per Kaiserschnitt geboren, kommt es während der Geburt nicht mit mütterlichen Vaginalkeimen in Kontakt. Es ist bekannt, dass Kaiserschnitt-Babys im Laufe ihres Lebens häufiger unter Allergien, allergischem Asthma, Übergewicht und verschiedenen Autoimmunerkrankungen leiden als Babys, die vaginal auf die Welt gekommen sind.
So wurde von Mikrobiomforschern in den USA vor einigen Jahren die Idee des Vaginal Seeding geboren. Die frisch per Bauchgeburt geschlüpften Babys werden dazu nach der Geburt bereits im OP im Mund, im Gesicht und an den Händchen mit dem Vaginalsekret ihrer Mütter benetzt, um diesen Keimtransfer zu imitieren. Auch einige Kliniken in Deutschland bieten das mittlerweile an. Sollte das aus unterschiedlichen Gründen keine Option sein, ist das BABY FLOR eine Idee, um dies zu ersetzen.
Deine Flora für Dein Baby …
Die Besiedelung mit einem besonders günstigen, physiologischen Keimspektrum, das wir von unserer Mutter weitergegeben bekommen, ist tatsächlich die Wiege unserer Mikrobiota, vermutlich lebenslang. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für unsere Gesundheit und beeinflusst alle nur denkbaren Organsysteme, von der wichtigen Barrierefunktion der Darmschleimhaut bis zur Gut-Brain-Axis.
Schon allein der Magen-Darm-Trakt eines frisch geborenen Babys muss Enormes leisten: Nahrung aufnehmen, sie peristaltisch weiterleiten, verstoffwechseln, wieder ausscheiden. Es dauert etwa 3 Monate, bis sich diese Vorgänge gut eingespielt haben. In dieser Zeit mühen sich viele Babys mit ihrer Verdauung. Das ist in einem gewissen Rahmen normal und auch nicht therapiebedürftig. Sollten aber gewisse Umstände für eine Dysbiose sprechen, kann die gezielte Gabe gewisser probiotischer Stämme dem Baby beim Aufbau einer gesunden, stabilen Darmflora helfen.
Ein präzises Probiotikum für Mama …
Im MAMA FLOR haben wir unterschiedliche Stämme kombiniert, die als gesunde Signaturkeime in der Vaginalflora vorkommen und die via entern-mammary-pathway auch in der Muttermilch landen.
Bifidobacterium breve
Kommt früh im Babydarm vor und wird über die Geburt und Muttermilch übertragen. Unterstützt die Verdauung komplexer Kohlenhydrate in der Muttermilch (HMOs) und stärkt so die Ausbildung einer gesunden Darmflora beim Neugeborenen. Assoziiert mit weniger Koliken und besserer Barrierefunktion.
Bifidobacterium infantis
Ein Schlüsselkeim der frühen Besiedlung. Besonders effizient in der Verwertung von HMOs aus der Muttermilch – kaum ein anderer Keim kann diese in gleichem Maße nutzen. Fördert eine stabile, probiotische Darmflora beim Baby und moduliert das Immunsystem in Richtung Toleranz.
Bifidobacterium longum
Weit verbreitet im Darm gesunder Mütter und Babys. Unterstützt die Barrierefunktion des Darms und kann entzündliche Prozesse dämpfen. Ein wichtiger Baustein in der Entwicklung des neonatalen Immunsystems, auch mit Blick auf Allergieprävention.
Lactobacillus crispatus
Einer der Leitkeime der gesunden vaginalen Flora. Produziert Milchsäure und Wasserstoffperoxid, was pathogene Keime hemmt. Sein Vorkommen wird mit einem geringeren Risiko für Frühgeburt, bakterieller Vaginose und Infektionen in der Schwangerschaft assoziiert.
Lactobacillus fermentum
Natürlich in der Muttermilch vorhanden. Studien zeigen eine lindernde Wirkung bei Mastitis und schmerzhaften Milchstaus. Unterstützt die Weitergabe gesunder Bakterien an das Kind und reduziert gastrointestinale Infekte in den ersten Lebensmonaten.
Lactobacillus gasseri
Ein häufiger Keim der vaginalen Flora, trägt zur Milchsäurebildung bei und stabilisiert das saure Milieu. Unterstützt die Barrierefunktion gegen pathogene Keime, sowohl in der Scheiden- als auch in der Darmflora.
Lactobacillus plantarum
Ein robuster, vielseitiger Keim, der auch in fermentierten Lebensmitteln vorkommt. Im Darm wirkt er entzündungsmodulierend und unterstützt die Schleimhautbarriere. Für Mutter und Kind kann er eine wichtige Rolle bei der Regulation der Immunantwort spielen.
Lactobacillus reuteri
Einer der am besten erforschten Stämme. Produziert das antimikrobielle Bacteriocin Reuterin, das gegen pathogene Bakterien und Viren wirkt. Kommt in Muttermilch vor, seine Häufigkeit hängt direkt von der mütterlichen Darmflora ab. Unterstützt Verdauung und Immunsystem des Babys.
Lactobacillus rhamnosus
Ein zentraler Keim der vaginalen und intestinalen Flora. Studien zeigen einen positiven Einfluss auf die Inzidenz von Atemwegs- und gastrointestinalen Infekten. Auch im Kontext von Allergieprävention in Schwangerschaft und Stillzeit untersucht.
Lactobacillus salivarius
Typischer Keim der Darmflora gestillter Säuglinge. Kann Wasserstoffperoxid bilden, das als Schutzfaktor für Vaginalflora und Babydarm dient. Fördert eine stabile, gesunde Mikroflora bei Mutter und Kind.
… und fürs Baby.
Das BABY FLOR kombiniert typische Frühbesiedler der kindlichen Säuglingsflora miteinander:
Lactobacillus rhamnosus
Ein wichtiger Keim der gesunden vaginalen Flora, in der Darmflora ist er assoziiert mit einer positiven Wirkung auf das Immunsystem, vor allem die Inzidenz von Atemwegserkrankungen.
Lactobacillus fermentum
Kommt natürlicherweise in der Muttermilch vor. Dieser Keim konnte in einer Studie Beschwerden durch schmerzhafte Milchstaus, ausgelöst durch Staphylokokken, lindern. Babys profitieren von einer probiotischen Gabe und weisen deutlich weniger Magen-Darm-Infekte im ersten Lebenshalbjahr auf.
Lactobacillus reutreri
Eines der bestuntersuchten Keime mit vielfältigen positiven Wirkungen. Auch er kommt natürlicherweise in der Muttermilch vor, deren Menge ist unmittelbar abhängig von der Anzahl im mütterlichen Darm. L. reuteri produziert Reuterin, ein Bacteriozin gegen schädliche Bakterien (etwa Clostridien) und gegen Rotaviren.
Lactobacillus salivarius
Ist der Signatur-Keim der Darmflora von gestillten Babys.
Bifidobacterium infantis
Dieses Bakterium ist ebenfalls als Probiotikum gegen Mastitiden bekannt. L. salivarius ist zudem ein Keim, der Wasserstoffperoxid (H2O2) synthetisiert, ein wichtiges Bakteriozin für die Vaginalflora und auch für die gesunde Babydarm-Barriere und sein Immunsystem.
Wann können Probiotika eine gute Idee sein?
Immer dann, wenn ein gestörtes Gleichgewicht der gesunden Flora vorliegt, kann sie mit gezielten Gaben spezifischer Stämme wieder „aufgeforstet“ werden. Nach Antibioatikagaben ist dies mittlerweile Standard und wird vielfach gleich mutempfohlen. Daneben gibt es typische Themencluster, die einen Blick aufs Mikrobiom werfen lassen:
Mama
- Alle Themen rund um vorzeitige Wehen oder (drohende) Frühgeburtlichkeit, auch in der Vorgeschichte
- Wiederkehrende vaginale Infektionen oder Blaseninfekte
- Infektionen mit B-Streptokokken
- Nach Antibiotikagabe
- Bei Brustentzündungen oder wiederkehrende Milchstaus/ Mastitiden, auch in der Vorgeschichte
- Dosierung: 2 Kapseln täglich, morgens vor dem Frühstück mit viel Wasser einnehmen
Baby
- Nach einer Bauchgeburt (Geburt mit einem Kaiserschnitt)
- Nach einer Antibiotikagabe unmittelbar vor oder während der Geburt oder später in der Babyzeit
- Nach wiederholten Candida-Infektionen in der Schwangerschaft
- Wenn Dein Baby nicht gestillt wird
- Ergänzend bei Mund- und/ oder Windelsoor
- Bei „Dreimonatskoliken“, wenn ein Ungleichgewicht der Darmflora dahintersteckt.
- Dosierung: 1-2 x tgl. 5-10 Tropfen vor einer Mahlzeit in den Mund tropfen
Mama Flor ist ein spezifisches Probiotikum, bestehend aus 10 wertvollen Stämmen verschiedener Bifidusbakterien und Lactobazillen
29,90€*
Quellen
Hanson, L. et al.: Feasibility of oral prenatal probiotics against maternal group B Streptococcus vaginal and rectal colonization. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 2014; 43 (3) 294–304
Hanson, L. et al.: Probiotic interventions to reduce antepartum Group B streptococcus colonization: A systematic review and meta-analysis. Midwifery 2022 (105) 103 208
McDonald, B. et al.: Maternal microbiota in pregnancy and early life. Science 2019; 365 (6457) 984–985
Fernández, L. et al.: Probiotics for human lactational mastitis. Benef Microbes, 2014 Jun 1; 5 (2) 169–183
Espinosa-Martos, I. et al.: Milk and blood biomarkers associated to the clinical efficacy of a probiotic for the treatment of infectious mastitis. Beneficial Microbes, March 2016; 7 (3) 305–318
Barthow, C. et al.: The Probiotics in Pregnancy Study (PiP Study): rationale and design of a double-blind randomised controlled trial to improve maternal health during pregnancy and prevent infant eczema and allergy. BMC Pregnancy and Childbirth, BMC series – open, inclusive and trusted 2016 (16) 133
Pelucchi, C. et al.: Probiotics supplementation during pregnancy or infancy for the prevention of atopic dermatitis: a metaanalysis. Epidemiology 2012; 23 (3) 402–414
Fernández, L.: The human milk microbiota: origin and potential roles in health and disease. Pharmacol Res 2013
Mar; 69 (1) 1–10
Kim, Y. H. et al.: Hydrogen peroxide-producing lactobacilli in the vaginal flora of pregnant women with preterm labor with intact membranes. Int J Gynaecol Obstet 93 (2000) 22–27
Wilks, M.: Identification and H2O2 production of vaginal lactobacilli from pregnant women at high risk of preterm birth and relation with outcome. J Clin Microbiol 42, 713– 717
Onderdonk, A. B. et al.: Quantitative Microbiologic Models for Preterm Delivery. J Clin Microbiol 2003 Mar; 41 (3) 1073–1079
Agrawal, B.M. et al.: Role of non-H2O2 producing lactobacilli and anaerobes in normal and complicated pregnancy. Journal of the Indian Medical Association, December 2002; 100 (11) 652, 654–655
Verstraelen, H. / Swidsinski, A.: The biofilm in bacterial vaginosis: implications for epidemiology, diagnosis and treatment Current Opinion in Infectious Diseases. February 2013 – Volume 26 – Issue 1
Metts, J. et al.: Lactobacillus acidophilus strain NAS (H2O2 positive) in reduction of recurrent Candidal vulvovaginitis. Journal of Applied Research 2003; 3 (4) 340–348
Roderick, A.: Probiotic strategies for the treatment and prevention of bacterial vaginosis. Expert Opinion on Pharmacotherapy, Volume 11, 2010 – Issue 18
Neu, J. / Rushing, J.: Cesarean versus vaginal delivery: long- term infant outcomes and the hygiene hypothesis. Clin Peri- natol 38 (2011) 321–331
Dominguez-Bello, M. G. et al.: Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer. Nat Med 2016 Mar; 22 (3) 250–253
Song, S. J. et al.: Naturalization of the microbiota developmental trajectory of Cesarean-born neonates after vaginal seeding. Med 2021 2 (8) 951–964
Mueller, N. T. et al.: Maternal Bacterial Engraftment in Multiple Body Sites of Cesarean Section Born Neonates after Vaginal Seeding – a Randomized Controlled Trial. Mbio 2023, e00491–23
Dominguez-Bello, M. G. in: Mikrobirth – Der größte Moment. Dokumentarfilm. Produktion und Regie: Toni Harman und Alex Wakeford, UK 2014
Amalia, N. et al.: Systematic review and meta-analysis on the use of probiotic supplementation in pregnant mother, breastfeeding mother and infant for the prevention of atopic dermatitis in children. Australas J Dermatol 61 (2020) e158–e173
Osborn, D. A./Sinn, J. K.: Prebiotics in infants for prevention of allergy. Cochrane Database Syst Rev, March 2013
Tang, M.L. et al.: Probiotics and prebiotics: clinical effects in allergic disease. Curr Opin Pediatr 22 (2010) 626–634
Pelucchi, C. et al.: Probiotics supplementation during pregnancy or infancy for the prevention of atopic dermatitis: a metaanalysis. Epidemiology 2012; 23 (3) 402–414
Fernández, L.: The human milk microbiota: origin and potential roles in health and disease. Pharmacol Res 2013 Mar; 69 (1) 1–10
Abrahamsson, T. R. et al.: Low diversity of the gut microbiota in infants with atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 129 (2) 2012, 434–440
Magazin . Das Leben | Familie | Kinderwunsch | Mama | Schwangerschaft
Eine kleine Geburt. Vom Umgang mit dem Unfassbaren.
Es geht heute um frühe Abschiede, wenn also ein Baby sich schon ganz zu Beginn einer Schwangerschaft verabschiedet. Zu einem Zeitpunkt, in dem das Schwangeren noch ganz zart, fragil und oft auch ein Geheimnis ist. Für die betroffenen Frauen ist es oft ein Fall ins Bodenlose. Fehlgeburten also.
Die meisten Fehlgeburten, die ich lieber Kleine Geburten nenne, ereignen sich im Rahmen einer so genannten Verhaltenden Fehlgeburt, medizinisch: die missed abortion.
VON Kareen Dannhauer


Sie macht sich erst mal nicht an bestimmten äußerlichen Symptomen bemerkbar. Oft wird nur zufällig bei der zweiten oder dritten Vorsorgeuntersuchung entdeckt, dass das Baby nicht mehr gewachsen und keine Herzaktion mehr nachweisbar ist. Eine Blutung fehlt also zunächst. Diese Diagnose ist immer ein Schock und eine emotionale Katastrophe. Dein Baby ist gegangen, einfach so.
Auch in meinem Buch war mir dieses Thema ein wichtiges Anliegen, denn der weitere Umgang damit ist in Deutschland noch weitgehend, mit Verlaub, hinter dem Mond. Noch immer ist es vielerorts medizinische Routine, die Frauen sofort für eine Curettage, eine Ausschabung also (warum nur gibt es in der Frauenheilkunde so viele verletzende, schmerzhafte Worte?). Und, ein weiterer Punkt, an den man vielleicht gar nicht so denkt: Fehlgeburten sind häufig. Etwa 20 % aller Frauen sind irgendwann in ihrem Leben davon betroffen.
Und natürlich ist das in den alleeseltensten Fällen notwendig (unten findest Du weitere und konkrete Zahlen, wir reden hier von weit über 90 %) und auf vielen nur denkbaren Ebenen eine weitere Verletzung der weiblichen Integrität.
Ich war sehr berührt über die Resonanz, die man erfährt, wenn man beginnt, darüber zu sprechen. Ein trauriges und schmerzendes Tabu irgendwie.
Meiner Freundin, der wunderbaren Okka Rohd, habe ich für Ihr Blog SLOMO gerade ein Interview gegeben, danke Okka, dass Du diesem Thema so feinfühlig und interessiert Beachtung und Verbreitung einräumst!
Ihr findest den Artikel hier.
Was du jetzt tun kannst:
- Erst mal gar nichts. Außer realisieren, was da geschehen ist. Zunächst stehst du unter Schock und machst von nun an – in sehr individuellem Tempo – alle Phasen der notwendigen Trauerarbeit durch. Bodenlose Verzweiflung, Trauer, Wut und natürlich auch die große Frage nach dem »Warum?« stürzen dich in eine emotionale Achterbahn. Von jetzt auf gleich ist alles anders.
- Ein winziger Hoffnungsfunken: Manche Babys wachsen auch zu Beginn einer Schwangerschaft sehr unorthodox. Von den gültigen Normwerten ist das zu halten, was immer von ihnen zu halten ist: Es ist die Mittellinie durch alle Ausreißer. Untersuchungen zeigen, dass ein abwartendes Verhalten auch bei leeren Fruchthöhlen und Babys ohne Herzschlag durchaus Sinn macht. Manche Babys scheinen zu einer ganz frühen Zeit in ihrem Wachstum und sogar mit ihrem Herzschlag auch so etwas wie in Winterschlaf zu fallen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, etwa zwei Wochen lang zu warten, um dann noch einmal zu schauen. Ich habe schon einige Babys im Wochenbett betreut, deren Müttern gesagt wurde: »Das wird nix, da sehe ich nichts. Da müssen wir eine Ausschabung machen.« Hänge nicht alles daran, aber überstürze eben auch nichts. Eine oder zwei Wochen lang abzuwarten und dann noch mal zu schauen – auch hier: nicht alle zwei Tage, weil du sonst innerlich durchdrehst – kann in jedem Fall eine Option sein.
- Wenn es doch so ist, dass dein Baby gegangen ist: Verarbeiten ist ein Prozess. Körper und Seele brauchen ihre Zeit. Deshalb ist es hilfreich, nichts zu überstürzen und in Aktionismus auszubrechen. Bis vor wenigen Jahren war es noch üblich – und in einigen Regionen ist es das bis heute –, den Frauen direkt nach der Diagnose, dass das Baby nicht mehr lebt, einen Überweisungsschein für die Klinik zur Ausschabung in die Hand zu drücken, wo sie sich spätestens am folgenden Tag auf dem OP-Tisch wiederfanden. Das ist weder notwendig noch ratsam. Für jede weitere Schwangerschaft ist es gut, die Gebärmutter wirklich in Ruhe zu lassen und sie keinem Verletzungsrisiko auszusetzen. Sie kann das alleine! Du kannst alternativ eine natürliche »Kleine Geburt« einfach zu Hause abwarten. Das kann allerdings dauern, manchmal nur einige Tage, manchmal auch (wenige) Wochen. Nur in ganz seltenen Fällen ist letztlich eine Curettage nötig! In vielen anderen europäischen Ländern, etwa Skandinavien, der Schweiz oder den Benelux-Ländern, ist dieses Vorgehen mittlerweile absolut üblich.
- Überlege zumindest, ob das eine Option für dich ist. Es ist verständlich, dass du erst mal innerlich die Flucht ergreifst und einfach nur in Narkose versetzt werden möchtest, in der Hoffnung, das könne auch deine unendliche Verzweiflung betäuben.
- Ein totes, winziges Baby in deinem Bauch – und einfach so abwarten? Manchmal ist das eine etwas unheimliche Vorstellung. Andersherum gedacht: Dort bei dir ist es noch ganz sicher und geborgen. Ganz sicher entwickelst du jedenfalls keine »Vergiftungs«- oder Sepsis-Symptome, zu deren Vermeidung du eilig etwas tun müsstest. Ganz im Ernst und ganz sicher: Es ist nicht gefährlich, einfach abzuwarten!
- Eine weitere Möglichkeit ohne langes Warten, welches manchen Frauen als zu große Herausforderung erscheint, und ohne eine Curettage ist die Gabe eines Medikaments, das recht zuverlässig eine natürliche »Kleine Geburt« auslöst, dazu findest du mehr unten!
- Suche dir eine Hebamme, die Fehlgeburten zu Hause begleitet. Sie unterstützt dich in diesem ganzen Prozess, körperlich, aber auch in deiner Trauer, mit allen deinen Fragen. Falls es nötig ist, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten der naturheilkundlichen Unterstützung, die deine Hebamme anwenden kann. Auch diese Hebammenbegleitung wird von deiner Krankenkasse übernommen.
- Ausnahmslos alle Frauen, die ich mit einer Fehlgeburt zu Hause begleitet habe, waren sehr glücklich und dankbar, einen Weg gegangen zu sein, der damit Bestandteil des »Lebens im Fluss« und der eigenen körperlichen Kompetenz war, der keine (chirurgischen) Maßnahmen unter Narkose gebraucht hat.
Wenn du gern auf eine Ausschabung verzichten möchtest, ist das Wichtigste, dass dir vorher klar ist, dass es Warten bedeutet, und dass das nicht immer leicht ist. Es kann wirklich dauern! Nimm dir diese Zeit zum Abschied nehmen, zum Weinen, für die Leere, die erst mal leer bleibt – für all das. Ich empfehle den Frauen immer als Erstes, einmal den Zyklus aus der Vor-schwanger-Zeit nachzurechnen. Oft verabschieden sich die Kinder zu einem Zeitpunkt, an dem du normalerweise deine Menstruation bekommen hättest, und auch begleitende Maßnahmen (siehe gleich unten) sind zu diesem Zeitpunkt besonders sinnvoll, weil dann die Gebärmutter offenbar auf mehr Aktivität eingestellt ist. Rechne also damit, dass es eher zwei bis drei Wochen dauert, bis dein Körper das Baby hergeben möchte, als zwei bis drei Tage.
Das Warten kann zäh sein, traurig, leer und lang. Und es ist eine Herausforderung, deinen Alltag mit diesem Geschehen in dir zu verbinden. Manchmal wirst du das Gefühl haben, nichts ließe sich jetzt damit vereinbaren. Wie sollst du weitermachen, als sei nichts geschehen, arbeiten, einkaufen, Kindergarten-Elternabend, Geburtstag einer Freundin? Und dabei darauf zu warten, dass du dein Baby endgültig verlierst? Manchmal tut es auch gut, sich mit diesen alltäglichen Dingen abzulenken. Die Sorge, es könnte jederzeit ohne Vorwarnung losgehen, du also unvermittelt zu bluten beginnst, ist fast immer unbegründet.
Im Nachhinein wird sich diese Zeit, die du dir genommen hast und die Wichtigkeit, die du damit diesem Kind, das ab jetzt für immer Teil deiner Biografie (und auch für immer dein Kind) sein wird, eingeräumt hast, für dich friedlich, gut und richtig anfühlen. Es ist manchmal ein notwendiger Weg, und manche Schritte, die wir im Leben zu gehen haben, lassen sich nicht abkürzen.
Dein Baby loslassen
Spüre achtsam nach, wie viel Zeit du euch geben möchtest und kannst, bis dein Baby sich von dir verabschieden kann und du dich von ihm. In Absprache mit deiner Hebamme kannst du ergänzend folgende Maßnahmen erwägen, ich habe hier nur die verkürzte Version aus dem Buch dringelassen. Einfach um unkundiges Anwenden in verantwortungsvolle Hände zu geben. Suche Dir Unterstützung!
Naturheilkundliche Maßnahmen, um dein Baby loszulassen:
- Hirtentäschel-Urtinktur
- Alternativ oder ergänzend: Hirtentäscheltee
- Ein gebärmutteranregendes Massageöl für deinen Bauch ist das Ut-Öl (Ingeborg Stadelmann). Massiere damit sanft deinen Bauch über dem Schambein. Es kann sein, dass diese Berührung deiner Gebärmutter, in dem dein Kind noch weich eingebettet ist, sehr emotional und berührend für dich ist. Nimm dir Zeit für alles, was da kommt, auch alle Tränen, die geweint werden wollen.
- Rainfarntinktur
- Vitamin C hochdosiert, 6 Gramm (etwa ein TL voll) gut über den Tag verteilt. In dieser Dosierung regt Vitamin C die Gebärmutteraktivität an. Achtung, die Darm-Peristaltik ebenfalls: Diese Dosis kann Durchfall auslösen. Am besten als Ascorbinsäure-Pulver, in einer dunklen Glasflasche aufgelöst, über den Tag verteilt trinken. Wenn dir das zu sauer ist, sind retardierte Kapseln eine Alternative.
- Homöopathie:Klassische Homöopathie kann ein ganz wunderbarer unterstützender Weg sein, das geht aber nicht hier auf dem schnellen Weg. Deine kundige Hebamme oder Heilpraktikerin kann Dich da gut begleiten.
- Senfmehlfußbäder wirken intensiv anregend und ausleitend: 2 EL Senfmehl (aus der Apotheke) in einen großen Eimer geben (gut ist es, wenn die halbe Wade mit hineinpasst), lauwarmes Wasser dazu geben. 10 bis 15 Minuten Füße baden, dabei ruhig nach und nach heißeres Wasser dazulaufen lassen (ansteigendes Fußbad). Wahrscheinlich werden deine Füße richtig warm, manchmal brizzelt es auch etwas. Danach ist die Haut wahrscheinlich leicht gerötet und brennt etwas, das ist normal. Creme oder öle die Füße gut ein, ziehe dir warme Socken an und lege dich zum Nachruhen ins Bett.
Schulmedizin: Ohne Curettage
Es gibt natürlich auch einen schulmedizinischen Weg, der ist in Deutschland aber eben noch nicht so bekannt. Dies wird sich in den nächsten Jahren ändern, weil die Zahlen dazu aus den Ländern (etwa Skandinavien, Benelux, Schweiz), in denen dies Verfahren mittlerweile ganz und gar üblich ist, einfach so bestechend gut sind. Einige Frauenärzte, und auch Kliniken, verordnen mittlerweile auch recht großzügig das Medikament Misoprostol (Cytotec®), welches im Off-label-Verfahren sowohl für eine Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung, als auch bei einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch verwendet wird. Dieses Medikament ist verschreibungspflichtig und löst bei einer missed abortion recht zuverlässig eine Fehlgeburt aus. Auch das kann also eine Option sein, wenn du nicht (weiter) warten kannst oder möchtest, aber dennoch am liebsten um eine Curettage herumkämest. Diese Tabletten werden vaginal angewandt, und es braucht eine valide Dosis: In den Studien dazu kommt es nach der vaginalen Gabe von 800 μg Misoprostol bei 90,6 Prozent, nach 600 μg bei 87,8 Prozent aller Frauen (das sind meistens 3 bis 4 Tabletten à 200 μg) zu einer vollständigen Fehlgeburt, die keiner weiteren Behandlung bedarf. Oftmals folgt das In-Gang-Kommen der »Kleinen Geburt« mit Blutungen und wehenartigen Schmerzen wenige Stunden später.
Wichtig ist hier, dass die Dosis auch stimmt. Manche Frauenärzte „trauen“ sich offenbar noch nicht so recht an diese noch neue und zudem Off-Label-Anwendung heran. Aber nur halbherzig einzelne Tabletten zu verteilen, bringt dann meistens original gar nichts.
Nur gehört eine solche medikamentös unterstützte Fehlgeburt auch in gute Begleitung, die der Frauenarzt im Praxisbetrieb oft nicht so gut übernehmen kann. Es ist nämlich wirklich eine Kleine Geburt, viel mehr das als eine verstärkte Menstruation! Viele Frauen unterschätzen den Umfang der Blutung, erschrick nicht darüber. Es ist gut möglich, dass mehrere Handvoll Blut mit Gewebsanteilen aus dir herauskommen, gar nicht selten löst sich auch die etwa walnussgroße Fruchthöhle und kommt gänzlich intakt aus dir heraus. Umso wichtiger ist deshalb auch hier Hebammenbegleitung in den Tagen drum herum; du selbst kannst und sollst nicht beurteilen, ob das alles richtig so ist.
Was passiert bei einer natürlichen Fehlgeburt
Die meisten Frauen beginnen zuerst stärker zu bluten und bekommen dann wehenartige Schmerzen, die sich – wenn du noch keine Babys geboren hast – ungefähr anfühlen, wie intensive Regelschmerzen. Es ist absolut in Ordnung, dabei Schmerzmittel zu nehmen. Bei einer Einleitung mit Cytotec® lasse ich meinen Frauen Ibuprofen 600 und Buscopan® da, die sie einfach nach Gefühl nehmen können oder auch gleich zusammen mit dem Cytotec®. Auch ein Tee aus Gänsefingerkraut kann helfen, Schmerzen zu lindern. Die Kräuterexpertin Margret Madejsky empfiehlt, das Kraut in Milch gesotten zuzubereiten: Nimm dazu 1–2 EL auf einen Viertelliter Milch und lasse alles zusammen 5–10 Minuten köcheln.
Am einfachsten ist es, wenn deine Frauenärztin dir Cytotec mitgibt, sodass du es zu Hause, an einem guten Ort, zu einem Zeitpunkt, den du selbst bestimmst, anwenden kannst. Wichtig ist, dass du nicht allein bist! Dein Mann kann bei dir sein und/oder eine Freundin. Und mit etwas Glück ist auch deine Hebamme in Rufnähe. Sorge für eine gute, gemütliche und geschützte Umgebung. Mach das Handy aus. Dein Mann wird vermutlich froh sein, irgendetwas tun zu können, vielleicht macht er dir Schnittchen und eine Wärmflasche. Ihr betrauert gemeinsam einen großen Verlust.
Von der Cytotec®-Gabe bis zum In-Gang-Kommen der Fehlgeburt dauert es meist eine bis vier Stunden. Viele Frauen unterschätzen den Umfang der Blutung – erschrick nicht darüber. Es ist gut möglich, dass mehrere Handvoll Blut mit Gewebsanteilen aus dir herauskommen. Manchen Frauen wird auch etwas übel und sie müssen sich übergeben. Gar nicht selten löst sich dann auch die etwa walnussgroße Fruchthöhle und kommt gänzlich intakt mit dem kleinen Embryo aus dir heraus. Manche Frauen wollen das Baby achtsam auffangen (zum Beispiel irgendwie absurd trivial mit einem Küchensieb) und vielleicht im Garten verbuddeln. Achte also darauf, wenn du auf die Toilette gehst: Es kann gut sein, dass es dort aus dir herausflutscht.
Hebammenbegleitung ist dabei und auch in den Tagen drum herum enorm wichtig und hilfreich. Allein bist du auf allen Ebenen damit ver- mutlich vollkommen überfordert. Du selbst kannst und sollst nicht be- urteilen, ob das alles so richtig abläuft. In seltenen Fällen kann eine Blutung auch mal so kräftig sein, dass du dich lieber in ein Krankenhaus fahren lässt. Verbluten wirst du aber ganz sicher nicht!
Curettage
Auch wenn es sich in den Abschnitten zuletzt vorwiegend darum drehte, wie du eine Ausschabung vermeiden kannst, ist eine solche natürlich nicht das Ende der Welt, obwohl sich vielleicht alles in dir gerade sowieso so anfühlt. Wenn alles Warten nicht zu einer spontanen (oder nicht zu einer vollständigen) »Kleinen Geburt« geführt hat, oder wenn das für dich kein denkbarer Weg war, ist eine Curettage in der Gynäkologie ein Routineeingriff, der nur wenige Minuten dauert. In vielen größeren gynäkologischen Praxen wird dieser Eingriff ambulant durchgeführt. Du bekommst dazu eine Narkose (eine kurze, angenehme, fast immer mit Propofol, einem intravenös verabreichten Narkosemittel) und kannst kurz darauf nach Hause gehen.
Nach einer Fehlgeburt
- Nach einer Fehlgeburt blutet es meist noch einige Tage lang leicht, etwa wie bei einer Menstruation. Einige Frauen haben noch einige Zeit – bis zu wenige Wochen lang – eine leichte Schmierblutung. Wenn du dazu etwas Unterstützendes unternehmen möchtest, kann → Frauenmanteltee oder → Nest-Tee eine gute Idee sein. Oft stellt sich dein Menstruationszyklus auch bald darauf wieder ein.
- Einige Frauen wollen am liebsten sofort wieder schwanger werden, andere brauchen etwas mehr Zeit. Aus meiner Erfahrung sind alle Empfehlungen zu den Pausen, die eingehalten werden sollten (sofort? Erst nach drei Zyklen?) nicht besonders hilfreich, das sagt auch die aktuelle Studienlage. Du wirst schwanger, wenn es wieder so sein soll, und auch dein Körper wieder bereit dazu ist. Der Verlust wird dich auf emotionaler Ebene sicher noch einige Zeit begleiten. Von einem Moment auf den anderen hat sich deine Lebensperspektive total verändert: Auch wenn dein Baby noch winzig klein war, war es eben doch schon ganz da. Mit allen Bildern, die du dazu im Kopf hattest: Du im nächsten Frühling mit Kinderwagen herumspazierend. Es gab schon einen ausgerechneten Entbindungstermin. Du hast schon mal verstohlen bei H&M in der Umstandsabteilung geguckt. Deine Eltern haben schon in überbordender Vorfreude das Familienbabybettchen vom Dachboden geholt. Alle diese kleinen und großen Dinge.
- Neben allem, was nun so unendlich traurig ist, ist auch das plötzliche Zuschlagen des Schicksals etwas, mit dem wir oft nicht rechnen. Das wirft uns aus unserer vermeintlich so sicheren Welt und nimmt uns etwas von dem Selbstverständlichen, vielleicht auch von dem naiv-romantischen Gefühl, dass immer alles gut geht. Es ist vielleicht im Moment nicht besonders tröstlich, aber auch glücklose Schwangerschaften sind in unserer Frauen-Fruchtbarkeitsbiografie etwas Normales, etwas das geschieht, und auch etwas, dass nicht grundsätzlich die Frage »Können wir jemals ein gesundes Baby bekommen?« verneint – auch wenn es sich jetzt gerade erstmal so anfühlt.
- Männer und Frauen trauern möglicherweise unterschiedlich, vielleicht hast du das Gefühl, dein Mann könne schon viel schneller zu etwas wie Alltag zurückkehren und fühlst dich unverstanden.
- Auch in deinem Umfeld warten manchmal Momente, in denen du still leidest und einfach unfassbar traurig bist. Vielleicht verkündet eine Freundin kurz darauf ihre Schwangerschaft – oder traut sich kaum, weil sie auch deine Geschichte mit dir geteilt hat – und du freust dich für sie, natürlich, aber …
- Rechne damit, dass es Zeit braucht. Eine kleine Narbe auf deiner Seele wird bleiben. Und ein kleiner Platz in deinem Herzen für dieses Kind auch.
Rockel-Loenhoff, Anna, Die Embryogenese im ersten Trimenon: Hebammenarbeit im Wissen um die Entwicklungsphasen, DHZ 2/2012.
Moore, Keith / Persaud, T.V.N., Embryologie, Entwicklungsstadien, Frühentwicklung, Organaogenese, Klinik. Urban & Fischer, 2007.
Abdallah, Y. / Daemen, A. / Kirk, E. / Pexsters, A. / Naji, O. / Gould, D. / Stalder, C. / Ahmed, S. / Bourne, T. / Timmerman, D. / Bottomley, C. / Syed, S. / Guha, S., Limitations of current definitions of miscarriage using mean gestational sac diameter and crown-rump length measurements: a multicenter observational study Ultrasound in Obstretics & Gynecology, 13 October 2011.
Gemzell-Danielsson, K. / Ho, P.C. / Gómez Ponce de Leon, R. / Weeks, A. / Winikoff, B., Misoprostol to treat missed abortion in the first trimester, International Journal of Gynecology and Obstetrics (2007) 99, S182–S185.
Esteve, J.L. / Varela, L. / Velazco, A. et al., Early abortion with 800 micrograms of misoprostol by the vaginal route, Contraception 59 (1999) 219–225.
Pandian, Z. / Ashok, P. / Templeton, A., The treatment of incomplete miscarriage with oral misoprostol, Br J Obstet Gynaecol 108 (2001) 213–214.
Barceló, Francisco / De Paco, Catalina / López-Espín, Jose J. / Silva, Yolanda / Abad, Lorenzo / Parrilla, Juan J., The management of missed miscarriage in an outpatient setting: 800 versus 600 μg of vaginal misoprostol, Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, February 2012, Pages 39–43.
Goldstein, R.R. / Croughan, M.S. / Robertson, P.A., Neonatal outcomes in immediate versus delayed conceptions after spontaneous abortion: a retrospective case series. Am J Obstet Gynecol. 2002 Jun;186(6):1230–1234
Magazin . Das Leben | Familie | Mama | Wochenbett
Mama hat das nicht mehr auf dem Zettel!
Eigentlich war der Plan anders: Du und dein Mann, ihr wolltet euch alles 50:50 aufteilen. Doch seit das Baby da ist, platzt dir vor lauter To-dos fast der Kopf – und zwar nur dir. Mental Load heißen die vielen Aufgaben, die (meist) Mama gedanklich jongliert. Warum es Zeit ist, dass Papa auch davon die Hälfte übernimmt. Und er dafür sicher nicht gelobt wird, nein!
VON Kareen Dannhauer


Mental Load ist eine neuere Vokabel, die dir vermutlich erst rund um die Geburt deines ersten Kindes über den Weg läuft. Vielleicht auch erst dann, wenn ihr schon in diese Falle hineingetappt seid, wenn du mitbekommst, dass für deine manchmal am Mutterglück nagende Unzufriedenheit bereits ein Wort gefunden wurde.
Was bedeutet Mental Load?
Dem Kind die Fußnägel schneiden. Wissen, wie gelbe Babykacke-Flecken aus Wolle-Seide-Bodys rausgehen. Das Ins-Bett-geh-Ritual einläuten. Überlegen, was morgen gekocht wird: In ungefähr 80 % der Familien machen das die Mütter, ohne, dass es irgendjemandem auffällt (außer den Müttern, vielleicht aber noch nicht mal denen).
Mental Load meint die Summe aus all diesen alltäglichen »Kleinigkeiten«, die wenig gesehen werden und kaum Wertschätzung erfahren, die aber irgendwie erledigt werden müssen. Es sind die 137 Tasks, die wir gleichzeitig offen haben und die einen stetigen Parallelhandlungsstrang bilden. Bei der größten Suchmaschine der Welt erzielt Mental Load mittlerweile dreistellige Millionenergebnisse.
Mental Load dürfte damit gleichzeitig diejenige Wortneuschöpfung sein, die beim Thema Kinderkriegen die höchste soziale Sprengkraft mitbringt. Sie rüttelt an Grundfesten, daran, wie wir bewusst und unbewusst sozialisiert worden sind. Wir sind die erste Generation, der immer »you can have it all« (meint zum Beispiel, klaro, Karriere und Kinder) versprochen wurde und die zumindest theoretisch mit einem Ideal von Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen aufgewachsen ist. Gleichzeitig wundern wir uns permanent, warum wir das alles irgendwie doch nicht so einfach unter diesen einen Hut bekommen.
Mütter, die an Väter delegieren müssen: Auch das ist Mental Load
Die Perspektive ist dabei eher die weibliche: Die Frau ist primär zuständig in diesen »Familie-und-Gedöns-Dingen« und delegiert (auch das: Mental Load) gewisse Teilaufgaben an den Mann. Das entspringt nicht den steilen Thesen irgendwelcher durchgeknallten Feministinnen, sondern basiert auf Zahlen: Frauen leisten in heterosexuellen Partnerschaften nach der Geburt eines gemeinsamen Kindes 52 Prozent mehr an Haushaltsarbeit, neudeutsch »Care-Arbeit« genannt.
Später mündet das in einen proportional zur Kinderzeit sich öffnenden Gender-Pay-Gap, in die Teilzeitfalle, die Altersarmut – all diese unattraktiven Dinge, die gefühlt so unendlich weit weg sind von der eigenen Realität. Erstaunlicherweise scheinen wir emanzipierten Millennials, Männer wie Frauen, nämlich das Ideal einer 50:50-Aufteilung nicht in die Realität umzusetzen, während wir so gern daran glauben, wir täten es.
„Aber Schatz, warum hast du denn nichts gesagt?“
Paare mit gemeinsamen Kindern, die sich trennen, tun dies heutzutage in einem hohen Maße, weil sie die gemeinsame Idee von Lebensgestaltung nicht auf die Reihe bekommen, weniger, weil sie sich fremdverlieben. Weil die als ungerecht verteilt empfundene Dauerbelastung die gemeinsame Idee von „Miteinander-Familie-Leben“ aushöhlen kann.
Ein weiteres zentrales Kennzeichen von Mental Load ist die höchst unterschiedliche Wahrnehmung derer, die darin gefangen sind. Exemplarisch heißt die wohl bekannteste Episode in dem 2018 erschienenen Comic der französischen Bloggerin Emma The Mental Load: „You should have asked!“ – „Aber Schatz, warum hast du denn nichts gesagt!“
Entlarvende Sätze für Mental Load
- Dein Mann hilft aber super im Haushalt! (Nein, er wohnt hier.)
- Hat dein Mann heute Kinderdienst? (Na ja, er ist der Vater …)
- Nimmt dein Mann auch die vollen beiden Monate Elternzeit?
(Es gibt keine „zwei Vätermonate“.) - Finde ich toll, wie dein Mann dir den Rücken frei hält! (Ähm …)
Und Maternal gatekeeping?
Manchmal wird im Kontext von Mental Load der Begriff des Maternal gatekeeping angeführt, nämlich dann, wenn vermeintliche Gründe für die ungleiche Lastenverteilung gesucht werden: Es wird argumentiert, dass die Mütter all die Baby- und Kinderaufgaben an sich rissen und ihren Männern, den Vätern, keinen Fußbreit im ihrem Hoheitsterritorium ließen.
Sie behandelten ihre Männer so, als seien diese ein wenig doof. Als würden die Kinder verhungern und erfrieren, wenn sie bei einem zweistündigen Ausflug nicht mit langen Listen, wollseidenen Schals und einer Tupperdose mit geschnitztem Bio-Obst ausgerüstet seien. Nichts kann man den Müttern recht machen!
Gefangen zwischen Resignation und Papa-will-gelobt-werden
Den Frauen wird mit diesem Argument nun also vorgehalten, dafür zuständig zu sein, ihrem Mann die Vaterrolle angenehm zu gestalten. Sie mögen ihn dazu bitte regelmäßig und ausgiebig loben, dass eine Windel gewechselt wurde, damit er bei der Stange bleibt. Selbst das Bundesfamilienministerium schlägt das in einer seiner Beratungsbroschüren ernsthaft vor.
Junge Mütter, die sich nun im Leben mit Kindern in der Dauerrolle als motzende Xanthippe wiederfinden, erleben das Abrutschen in die Mental-Load-Falle hingegen eher als Resignation: Bevor ich zum dritten Mal erkläre, in welchem Bioladen die glutenfreien Kekse für die Schwägerin, die am Wochenende zu Besuch kommt, zu finden sind, bei welcher Gradzahl die Wollwalkanzüge gewaschen werden müssen oder wie noch mal der Kinderosteopath heißt, bei dem man lange in der Telefonwarteschleife hängt, um den ersehnten Termin zu bekommen – macht man es doch schnell lieber selbst. Und hin und wieder knallt es dann, und niemand versteht, »was denn plötzlich mit Mutti los ist«.
Magazin . Baby | Das Leben | Familie | Mama | Papa
Hebammen-Tipps: Wie viel oder wenig Sonne braucht ein Baby?
Kaum wagen sich die ersten Sonnenstrahlen im Frühling zaghaft auf die Erde, erwacht nicht nur die Natur aus ihrem Winterschlaf, auch wir Menschen genießen nun wieder die längeren Tage, die laue Luft und das Licht. Und mit Kindern ist für uns Eltern endlich die lange Zeit vorbei, in der wir auf Sandkästenrändern saßen, mit klammen Fingern, und uns fragten, ob man das wirklich toll finden muss, Förmchenbacken bei 2 Grad und Nieselregen. Wobei es immer zu meinen pädagogischen Grundregeln gehörte, wahrhaftige Begeisterung gegenübern den Kindern zu demonstrieren, weil es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur ungeeignete Klamotten, frische Luft, und so weiter, stimmt ja auch alles. Ich großstadtverzärtelte Mutter. Es sah aber tatsächlich auch immer so aus, als käme diese Botschaft bei meinen Mädels an. Fröhliche rotwangige Gesichter in Wolle-Seide, Wollwalk und Buddelhosen. Und ich entdeckte Thermoskannen wieder ganz neu und Gummistiefel.
VON Kareen Dannhauer


Kaum, dass aber der Mai die ersten wirklich warmen Tage beschert, wird ein ganz anderes Thema wichtig: Sonnenschutz. Baby´s Haut ist ja so empfindlich. Und so fallen Babys und Kleinkinder dann bald schon von weithin sichtbar auf: Unter Sonnenmützen mit Nackenspoilern leuchten kleine weiße Gespenstergesichter hervor. Alle anderen Hautpartien sind von langärmliger UV-Schutzkleidung verdeckt. Ist das sinnvolle Vorsicht angesichts der gefährlichen UV-Strahlen? Oder übertrieben? Oder gar kontraproduktiv?
Um es vorwegzunehmen: Ein wichtiger Knackpunkt an dieser Stelle heißt:Vitamin-D-Synthese.
Kaum, dass aber der Mai die ersten wirklich warmen Tage beschert, wird ein ganz anderes Thema wichtig: Sonnenschutz. Baby´s Haut ist ja so empfindlich. Und so fallen Babys und Kleinkinder dann bald schon von weithin sichtbar auf: Unter Sonnenmützen mit Nackenspoilern leuchten kleine weiße Gespenstergesichter hervor. Alle anderen Hautpartien sind von langärmliger UV-Schutzkleidung verdeckt. Ist das sinnvolle Vorsicht angesichts der gefährlichen UV-Strahlen? Oder übertrieben? Oder gar kontraproduktiv?
Ab einem Sonnenschutzfaktor 15 findet die nämlich gänzlich nicht mehr statt. Kein einziges Nanogramm Vitamin D kann in der Haut gebildet werden, wenn Kinder eine adäuquaten Sonnenschutzcreme tragen, egal wie prall die Sonne dann ist.
Für die Praxis heißt das folgendes:
- Kinder brauchen Licht und Sonne. Nicht nur das Vitamin D ist von Bedeutung, sondern auch die Botenstoffproduktion im Gehirn. Die wird von der Sonne getriggert, wie wir alle wissen: Wie wohltuend ist das Frühlingslicht nach dem langen, dunklen Winter, auch mit bisweilen dunkleren Stimmungstönen! Darüber hinaus ist die Sonne Sinnbild für Wärme, Lebensfreude, das Leben selbst. Kinder und Erwachsene brauchen Licht, Luft, Liebe – und Sonne.
- Gleichzeitig braucht die Haut Schutz vor einem Zuviel. Ein Zuviel bedeutet: Rötung und später (also zu spät: Sonnebrand). Jeder Sonnebrand im Kindesalter sollte wirklich vermieden werden, das senkt das Hautkrebsrisko in späteren Lebensjahrzehnten deutlich.
- Es sollte also heißen: „Sonnenbrandschutz“ und nicht „Schutz vor Sonne“. Je nach Lebensalter der Kinder bedeutet das Unterschiedliches.
- Babys im ersten Lebensjahr sollten keine Sonnencreme auf die Haut geschmiert bekommen. Der Grund dafür ist die zarte, dünne Haut und die damit noch nicht ausgebildete Hautbarriere. Sonnenschutz in Kosmetika (sowohl mineralische, also physikalisch wirksame als auch chemische Uv-Filter) sind sehr komplex.
- Deshalb ist es im ersten Lebensjahr besonders wichtig: Der Sonnenschutz besteht aus langer, luftiger Kleidung und einem Schattenplatz. Dabei den Kinderwagen nicht komplett zuhängen, vor allem Modelle in schickem schwarz – Achtung Wärmestau! Die pralle Mittagssonne meiden und zur Siesta nach drinnen gehen, vor allem in südlichen Ländern, am Meer und im Hochgebirge.
Between eleven and three – stay under a tree.
- Besonders empfindlich ist das Köpfchen: Schütze es immer, immer mit einem breitkrempigen Hut, der auch den Nacken beschattet. Auch später können größere Kinder sonst durchaus auch mal einen Sonnenstich bekommen (gerade auch am Meer, wenn durch die leichte Brise und nasse Haare die Hitze der Sonne gar nicht so heiß erscheint). Für einen Sonnenstich, der sich mit Kopfweh, leichtem Fieber, manchmal auch mit Erbrechen äußert, sind die langwelligen Infrarotstrahlen der Sonne, also die Wärmestrahlung verantwortlich.
- Ein sehr wirksamer Sonnenschutz jenseits des ersten Baby-Sommers ist: sanfte Sonnengewöhnung. An „normalen“ deutschen Sommertagen, die Dein Kind auch immer mal wieder in festen Etappen drinnen verbringt (wie etwa im Kindergarten) brauchen nur die sehr empfindlichen Hauttypen Sonnencreme. Meiner Erfahrung nach achten die ErzieherInnen wirklich höchst akribisch auf Sonnenschutz in allen Formen, suchen den Schatten und achten auf Käppis.
- Vitamin-D-Bildung in der Haut benötigt verschiedene physikalische Bedingungen. Die Sonne muss ausreichend hoch am Himmel stehen, das bedeutet für Deutschland: Jenseits der Monate April bis September reicht der Einstrahlwinkel nicht für eine ausreichende Bildung aus, egal, wie viel wir draußen unterwegs sind. Und vor 11 und nach 16 Uhr reduziert sich die Syntheserate ebenfalls gen null ab. Es braucht also tatsächlich pralle Sonne mit ausreichend belichteter Hautfläche (also mehr als Unterarme und Gesicht). Weil das für Babys eben nicht empfehlenswert ist, gibt es folgerichtig für alle Babys über zwei Winter hinweg die offizielle Substitutionsempfehlung mit 500 IE Vitamin D am Tag.
- Größere Kinder und Erwachsene laden – zumindest theoretisch – ihre Vitamin D-Reserven über den Sommer so weit auf, dass sie damit immerhin über den Herbst bis Frühwinter kommen und ausreichend versorgt sind. Dafür ist aber auch regelmäßiges Sonnenbaden mit möglichst viel nackter Haut notwendig, und zwar ohne UV-Filter. Wer vor dem Verlassen der Wohnung Sonnencreme aufträgt, synthetisiert auch kein Vitamin D. Nichts. Nada. Zero. Für eine ausreichende Bildung wird ungeschützte Sonnenexposition empfohlen, und zwar die Hälfte der Eigenschutzzeit (also die Hälfte der Zeit, die es ungeschützt bräuchte, um einen Sonnenbrand zu bekommen). Mit einem halbstündigen Ganzkörper-Sonnenbad kann der Körper eines Erwachsenen (in Abhängigkeit verschiedener Faktoren) etwa 10.000 IE Vitamin D bilden.
Wie ich das selbst handhabe? Meine Kinder sind zuhause in der Stadt tatsächlich so gut wie nie eingecremt, und zwar von kleinauf an, und möglichst viel draußen. Im Kindergarten musste ich das Nicht-Cremen den ErzieherInnen gegenüber tatsächlich ziemlich offensiv verteidigen. Wenn wir an den See fahren oder auch an sehr sommerlichen Tagen einen Komplett-Tag im Park verbringen, werden sie eingecremt, am Meer und im Urlaub in südlichen Gefilden natürlich auch. Sie hatten noch nie in ihrem Leben einen Sonnenbrand. Über den Winter bekommen sie sporadisch höhere Dosen Vitamin D.
Welche Sonnencreme ist empfehlenswert?
Die für Kinder geeignete Sonnencremes benutzen physikalische Filter. Das sind winzig kleine Partikel (aber bestenfalls groß genug, um eben keine problematischen Nano-Partikel zu sein, einige Kindersonnencremes enthalten diese!) von Zink- oder Titandioxid, die das Sonnenlicht reflektieren. Deshalb erscheinen sie nach dem Auftragen mehr oder weniger weiß auf der Haut. In der Naturkosmetikszene sind diese unterschiedlichen Filtermöglichkeiten wiederum sehr unterschiedlich bewertet, speziell Korund wird immer wieder diskutiert, da es im Rahmen der “Aluminium-Diskussion” immer wieder erwähnt wird. Eco-Cosmetic, ein Hersteller von sehr guter Kindersonnencreme (persönliche Meinung, keine Kooperation, keine beauftragte oder bezahlte Werbung) schreibt dies hier dazu. Chemische Filter sollten für Kinder möglichst gar nicht verwendet werden. Einige von ihnen (etwa Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycinnamat) stehen im Verdacht, hormonähnlich und allergieauslösend zu wirken, die Ergebnisse dazu der ETH Zürich gibt es hier.
Da ich diesen Blog-Artikel nicht fortlaufend mit neuen Testergebnissen und Neuerscheinungen ergänzen kann, ist es sicher von Sommer zu Sommer noch mal eine kurze Recherche wert, wenn Dir diese Aspekte wichtig sind.
Einen aktuellen Artikel aus dem März 2018, in dem auch konkrete Produktnamen genannt werden, findest Du hier.
Eine gute und verständliche Zusammenstellung der Wirkung von Sonne und Vitamin D findet sich hier
Eines meiner Lieblingsblogs, wie schon verschiedentlich erwähnt, ist Kinder verstehen von Herbert Renz-Polster. Der Sonne-Artikel ist ebenfalls ganz wunderbar.
Und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt etwas zum Sonnenschutz für Kinder.
Magazin . Baby | Das Leben | Familie | Mama | Papa
Braucht mein Baby wirklich Tierkekse? Liebe Eltern, entspannt euch
Eltern wollen alles richtig machen – vor allem beim Thema Ernährung sind sich die meisten Mütter in meinem Umfeld eigentlich einig: Gesund soll es sein. Bio womöglich. Viel Gemüse und so. Und, bevor ich ein anderes Mal ausführlicher auf das Thema Thema Baby-Beikost eingehe sind ein paar ganz grundlegende Sachen beim Umgang mit Baby- und Kleinkindessen viel, viel wichtiger. Die meisten „Probleme“, wegen derer ich in der Beikostberatung als Hebamme angefragt werde, resultieren aus Mythen, die sich hartnäckig halten – und die uns das Leben mal wieder unnötig schwer machen. Hier kommen 7 weitverbreitete Irrtümer rund ums Essen im Baby- und Kleinkindalter:
VON Kareen Dannhauer


Sieben Mythen über das Essen im Baby- und Kleinkindalter:
Ab jetzt wird alles kompliziert.
Nein. Essen ist nicht kompliziert. Sicher ist nun alles neu, und natürlich wollen wir immer gern alles richtig machen. Beim Thema Essen kann man es wirklich umdrehen: Es gibt weniges, das Du wirklich nicht tun solltest. Das kommt gleich alles. Und wenn Du diese Dinge weglässt, ergibt sich fast alles Richtige von selbst. Du brauchst also keinen Urlaub abwarten oder ein sonst wie kompliziertes Scheduling dafür aufsetzen. Fang einfach an – wenn Dein Baby bereit ist (aufmerksam beim Essen schaut, nach Essbaren grabscht, sich drehen kann, um ein paar der wichtigsten Reifezeiten kurz zu benennen) und es sich einfach irgendwann ergibt, wenn Dein Baby zwischen fünf bis sieben (vollendete) Monate alt ist.
Wir brauchen einen Plan. eine Tabelle. Irgendwas.
Nö. Die mittlerweile schon fast sprichwörtliche “Mittagsbrust”, die Du laut solcher Tabellen als erstes ersetzen solltest, ist graue Theorie, und noch nicht mal da funktioniert sie. Welche Mittagsbrust soll es denn sein? Die um 11, 12, 13 oder 14 Uhr? Starte dann, wenn es passt. Am besten dann, wenn Du auch selbst etwas isst. Denn eines der wichtigsten Kontexte in Sachen “Essen” ist das soziale, gemütliche Miteinander. Und auch das “Lernen durch Nachahmen”, welches Dein Baby permanent praktiziert. Ob das mittags, nachmittags oder abends ist: Total egal.
Beikost ersetzt die Stillmahlzeit.
Sagen wir mal so: Zumindest dauert das noch eine ganze Weile. Beikost ist nicht Muttermilchersatzkost, sondern Muttermilchergänzungskost, wie die Präposition “Bei-” ja schon vermuten lässt. Realistische Erwartungen sind da – wie so oft – hilfreich: Wenn Du zügig abstillen möchtest, gibt es sicherlich andere Lösungswege, als dann, wenn Du noch gerne stillst und nicht in den nächsten wenigen Wochen damit aufhören möchtest. Aus meiner Erfahrung auch hier: Go with the Flow. Kaum eine Mutter hat sich bereits in der Schwangerschaft vorstellen können, so lange zu stillen, wie sie es dann letztendlich tut (und im besten Fall auch genießt). Mach also keine allzu langfristigen Pläne, viele von denen wirst Du eh auch wieder über den Haufen werfen. Nichts drängelt, gar nichts.
„Richtiges Essen“ und dann klappt´s auch mit dem Durchschlafen.
Unpopulär, dieses “Nein” auch hier, aber ebenfalls wahr. Dass Dein Baby vermutlich genau jetzt im typischen Beikosteinstiegsalter wieder unruhiger schlafen lässt und Du bisweilen 2-stündlich (oder öfter) stillst, ist kein Zeichen für “Milch reicht nicht mehr”, sondern für eine typische Entwicklungsphase, in der sich Dein Baby immer wieder des sicheren Mama-Hafens vergewissern muss. Muttermilch ist kaloriendichter als jedes Karottenbreichen. Damit löst Du dies Thema also nicht. Sorry. Da diese Themen aber zumindest zeitlich zusammen liegen, ist das auch nochmal ein Anlass, mit Deiner Hebamme einen Termin zu verabreden und darüber zu sprechen. Auch wenn sie auch diesmal kein Patentrezept für eine easy-Lösung aus dem Hut zaubern kann.
Kinder brauchen spezielles Kinderessen.
Zu diesem Thema habe ich mich anlässlich der #gesichtswurstwoche wohl hinreichend aufgeregt. Und ein bisschen das Stilmittel der “dosierten Provokation” gewählt und obiges Bild mit “Gesichtswurst für Biomuttis” untertitelt. Weil diese Trennung von “Erwachsenenessen” und “Kinderessen” per se artifiziell und kontraproduktiv ist. Und eine Spirale: Ein Kind, das einmal zuckerhaltige Tierkekse (voll bio, ist klar) gegessen hat, wird beim nächsten Schwarzbrotstückchen an dessen Stelle zurecht protestieren. Vernunft, Maß, Geduld – ist Baby´s und Kleinkind´s Sache nicht. Denn natürlich schmeckt der Keks besser als das Schwarzbrot. Denn er ist süß, und evolutionsbiologisch betrachtet ist das ganz oben auf der Atttraktivitätsskala. Schnell zugängliche Energie. Kinder mögen das, und das ist angeboren. Später aber setzt eine Konditionierung ein, und wir reagieren oft im Vorauseilenden Gehorsam: Wir kaufen Kinderjoghurt mit irgendwelchen Monstern drauf, Wurst mit Gesicht oder in Fußballform und bestellen im Restaurant “Biene Maja” (Spaghetti mit Tomatensoße) oder “Pinocchio” (Schnitzel mit Pommes). Wer das etabliert hat, mit Verlaub, zwei Jahre später: Selber Schuld.
Und, zurück zum Baby und zum Start mit dem Essen: Es gibt keinen einzigen Grund, Brei aus Gläschen zu füttern. Man startet damit nämlich gleich mit Konserven-Essen. Baby-Menü aus dem Glas ist Ravioli aus der Dose. Essen kochen mag erstmal aufwendig erscheinen, ist es, wenn Du es Down to Earth hältst, aber nicht. Und es ist vermutlich ein gelerntes Muster, das wir so gar nicht hinterfragen. Als kleinen Test empfehle ich den Eltern, die das erstmal ganz neu und ungewohnt finden, etwas anderes zu machen, als die angenommene Normalität (nämlich Gläschen), die uns die Babykostindustrie natürlich glauben machen möchte, das selbst mal zu probieren. Danach ist die Entscheidung meistens ganz leicht.
Ausnahme ist Ausnahme und Regel ist Regel.
Für einige Menschen klingt vieles jetzt möglicherweise sehr nach Dogma. Auch meine Kinder haben natürlich schon Fruchtzwerge und Kindermilchschnitte gegessen – und lieben es. Natürlich. Ist ja auch lecker. Kinder sind klug. Und können unterscheiden: Das ist die Regel – also das, was bei uns täglich auf dem Tisch steht und im Kühlschrank zu finden ist – und was ist die Ausnahme: Es gibt “Cheat-Meals”, es gibt Urlaub, es gibt Oma und Opa und es gibt Kindergeburtstage. Das reicht. Wenn nach jedem Abholen aus dem Kinderladen ab dem zweiten Geburtstag aber als erstes der Bäcker die Eisdiele angesteuert wird – darf man sich natürlich auch nicht wundern.
Man startet am besten mit Brei.
Auch dieses Konzept ist mittlerweile überholt, grundsätzlich kann man sagen, dass auch der wissenschaftliche Trend und die offiziellen Empfehlungen die “klaren Regeln” ziemlich aufgeweicht hat. Fingerfood kann eine Ergänzung oder ein “anstatt” des klassischen Babybreis sein. Die “Reine Lehre” in Sachen Fingerfood statt Brei heißt Baby Lead Weaning, Baby-geführte Entwöhnung. Das ist auch ein Extrathema, wer sich belesen möchte, dem sei das Buch Einmal breifrei bitte meiner Kollegin Eva Nagy ans Herz gelegt.
Wenn Babys kein Gemüse-Essen lernen, tun sie es nie.
Ja und nein. Es ist in jedem Fall ratsam, dem Baby und später dem Kleinkind alles das vorzusetzen, was es bei Euch eben so zu essen gibt. Trau Dich, be fancy. Algensalat oder Rheinischer Sauerbraten – und lass Dich überraschen. Dein Baby darf das alles (ja, auch schon mit acht Monaten), und Du wirst staunen, was es alles probiert und lecker findet, gerade im ersten Lebensjahr sind Babys noch ziemlich neugierig. Untersuchungen sagen, dass die meisten Kinder unvertrautes Essen annehmen, wenn sie es etwa 10 Mal probiert haben und wenn die Eltern es selbst regelmäßig essen, also mit ihrem elterlichen Vorkosterdasein zuverlässig signalisieren, dass das auch wirklich lecker ist. Das kann man auch gerne übertrieben begeistert immer wieder SAGEN. “Hm, lecker, Brokkoli!” So etwa in der Art.
Der Satz “Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt” stimmt in der Weise, als dass Babys eben so aufwachsen, wie ihre Eltern es gestalten. Schon Deine Vorlieben in der Schwangerschaft lassen das Fruchtwasser unterschiedlich schmecken (jeder, der schon mal einen Blasensprung nach einer Spargelmahlzeit gerochen hat, weiß das, ich gehöre zu diesem ausgewählten Personenkreis), und bei der Muttermilch ist es genau so.
Das klingt erstmal ganz einfach, so als könne man Essen später im Kindergartenalter als Eltern mit dem richtigen Einfädeln beliebig steuern. Mit den obigen Maßnahmen oder schlicht Verhalten kannst Du schon ganz viel tun. Aber – wie so oft – haben Babys doch ein ordentliches Wort mitzureden. Und es gibt Babys, deren Geschmacksknospen so sensibel sind, dass sie feinste Bitterstoffe herausschmecken, etwa 20 % aller Kleinkinder gelten als so genannte Supertaster. Und bei denen kann man sich im Zweifel auf den Kopf stellen, die mögen einfach kein Gemüse, weil sie es wirklich nicht runterkriegen. Zu diesen Kindern, die oftmals tatsächlich phasenweise nur Nudeln ohne Alles essen hat der grandiose Kinderarzt, Wissenschaftler, Buchautor und Vater Herbert Renz-Polster hier einen wunderbaren Vortrag gehalten, den ich Euch gern nochmal verlinke. Unbedingt angucken, denn wichtig ist hier mal wieder die Kernaussage: Keep cool, auch diese Kinder wachsen und gedeihen – auch ohne Brokkoli.
Magazin . Das Leben | Familie | Mama | Papa
Smartphone und Bindung
Neulich war ich auf dem Attachement Parenting Kongress in Hamburg. Ich war dort eingeladen als Hebamme, aber auch anwesend als Mutter (und im Gepäck mein Inneres Kind selbstredend auch).
Meine Kinder sind ja nicht mehr so ganz klein (8 & 13) und deshalb wachse ich naturgemäß auf meiner eigenen Mutterreise auch in immer neue Themengebiete hinein. Eines davon ist die bei uns in der Familie so genannte Mediennutzung, und damit ist vor allem das Smartphone gemeint. Meine große Tochter besitzt seit einem Jahr (das ist überdurchschnittlich spät) ein Smartphone, die kleine natürlich noch nicht. Aber hier fliegen insgesamt ein paar Endgeräte herum, es gibt Regeln und im Groben halbwegs gesitteten Umgang damit.
VON Kareen Dannhauer


Man sagt ja, Kinder seien immer Dein unverstelltester Spiegel in vielerlei Hinsicht. Das zwingt einen natürlich permanent zur Selbstreflexion, was man gemeinhin mit Gelegenheit zum inneren Wachstum verklärt. Oder auch Gelegenheit zur inneren Verzweiflung. Sprich: Regelmäßig bin ich natürlich ratlos. Theorie-und-Praxis-Gap und so. Ich besitze ein Smartphone, ich benutze es, großteils auch durchaus gern, ich benutze es beruflich, manchmal weil ich Lust habe, manchmal natürlich auch nicht, dann ist es eine Last, die immer piepst, manchmal benutze ich es auch aus Reflex oder suchtähnlichen Verhaltensweisen. Ich liebe es und ich hasse es. Und beobachte den Umgang meiner Kinder mit eben den gemischten Gefühlen.
Weil mich dieses Thema privat gerade sehr beschäftigt, habe ich natürlich in mehreren Vorträgen (in denen es zentral eigentlich um ganz Anderes ging) zarte Hinweise auf dieses Thema in mein eigenes, das ich selbst damit gerade am Start habe, eingebaut. Man hört ja immer die Botschaften, die gerade etwas mit einem selbst zu tun haben.
Davon habe ich zu einigen Gelegenheiten erzählt, mehr im Nebensatz eigentlich, und wurde dann sehr interessiert danach gefragt, „was man (also die Experten auf dem Kongress) dazu gesagt hätte”, wo es ja um Bindung ging. Ich scheine also absolut nicht die einzige zu sein, der es so geht.
Im Falle meiner etwas größeren Kinder ist der primäre Bindungszug natürlich abgefahren, oder besser und hoffnungsvoll fomuliert: längst auf ein gutes Gleis gekommen. Zufällig habe ich die Babyzeit mit meinen eigenen Kindern tatsächlich (vor 13 und 8 Jahren) smartphonefrei verbracht, ich bin sozusagen haarscharf daran vorbeigeschrammt, und das ausschließlich als Gnade der frühen Geburt. Ich bin tendenziell dankbar darüber.
Denn das müssen wir uns im Wesentlichen bewusst machen: Es handelt sich bei allem, was wir über unsere Mediennutzung und deren Auswirkung mutmaßen, um einen irre kurzen Zeitraum, in dem wir überhaupt erst konfrontiert sind. Eine Veränderung unserer kommunikativen Interaktion mit Menschen, der unser aller Leben massiv beeinflusst. In so vielerlei Hinsicht. Gute Sachen und nicht so gute Sachen – aber eben ein massiver, ich sag hier noch mal ein anderes großes Wort: erdrutschartigen Einfluss.
Wir alle ahnen, dass wir quasi Teilnehmer einer großangelegten Langzeitstudie in Sachen Kommunikation und sozialer Interaktion sind, und das macht uns eben auch so unsicher damit. Denn kein Mensch kann uns sagen, was das auf Dauer für Konsequenzen hat. Wir können nur unseren gesunden Menschenverstand einschalten. Und dann wundern uns bestimmte Dinge natürlich überhaupt nicht.
Wir suchen also nach Expertenrat. Gibt es nicht vielleicht schon irgendwelche Studien (wir modernen Mütter glauben sehr an die Kraft von “Studien”), die uns in unserem eigenen Zweifel mal bitte sagen, was da jetzt gut ist und was nicht und was wir hysterisch übertreiben und was wir uns schönreden? Um es da schon mal kurz zu machen: Nein, in dieser Form gibt es die natürlich noch nicht. Wir sind also aufs Selber-Nachdenken angewiesen.
Katja Seide (Das gewünschte Wunschkind) erwähnte in ihrem Vortrag auf jenem Kongress (Thema: “AP jenseits der Baby- und Kleinkindphase – Gelassen durch die Jahre 5-10”) im Kontext “Kindheit heute und gestern” (u.a. mit einer spannende Grafik zu den unbeobachtete Freiräumen) die angestiegene Unfallzahl auf Spielplätzen in den letzten sechs Jahren. Wundert das irgendwen? Mich nicht. Diese komische Mischung aus Langeweile und kurzfristiger Interaktion (Ok, ich komm´ Dich gleich Anschubsen, Auffangen, Hochheben) – natürlich verleitet das dazu, immer mal kurz aufs Händi zu gucken, schließlich hat es ja schon dreimal wieder vibriert. Oder nur mal schnell den Feed durchscrollen. Wer kennt das nicht. Wer macht das nicht, die einen natürlich mehr, die anderen weniger. Ich mache das auch, natürlich, mit einem schlechten Gewissen, manchmal, manchmal aber auch nicht.
Man könnte in diesem Konglomerat aus Aspekten so viele einzelne betrachten, ich beschränke mich mal auf zwei: Aufmerksamkeit und Blickkontakt, und ich gehe zeitlich nochmal ein Stückchen weiter zurück und verlasse den Spielplatz, ich schaue mal auf die Babyzeit.
Blickkontakt ist essentiell für die Bindungsentwicklung, immer und immer wieder, das weiß man natürlich schon lange. Man weiß schon lange, dass Kinder das Gegenüber, das Antlitz brauchen, um ihre Emotionswelt in einem Gegenüber zu spiegeln. Und feinste mimische Veränderung von Mama zu erkennen, um die Situation einzuschätzen. Deshalb mustern Babys ihr Gegenüber auf diese unendlich tiefgründige Weise. Sie sind darauf angewiesen. Mamas Lächeln zeigt: Ich bin geliebt und sicher. Und die Umgebung ist es offenbar gerade auch, kein Säbelzahntiger in Sicht. Antlitz schafft und vertieft Bindung.
Im Umkehrschluss, was also mangelnder Blickkontakt mit Babys macht – das wussten übrigens auch die Nazis, als Johanna Haarer den Müttern in ihrem Buch “Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind” ausdrücklich davor warnte, ihr Baby allzu verliebt anzusehen beim Stillen. Denn in der Weimarer Republik war eins ganz und gar nicht erwünscht: Bindung. Wer seine Söhne in den Krieg schicken können muss, muss such das hart erarbeiten, von Beginn an.
Für die Kinderwagenhersteller waren die Erkenntnisse der Bindungsforschung in den letzten Jahren ein wesentlicher Grund, die Babyschalen bei den meisten Modellen umdrehen zu können, so dass die Blickrichtung der Babys den Müttern zugewandt ist. Man weiß (ja, dazu gibt es Studien), dass die Interaktion von Müttern und Babies, verbal und mimisch, natürlich viel, viel ausgeprägter ist, wenn man sich sieht. Man kriegt einfach mehr voneinander mit (“na, musst Du niesen?”) und man kriegt mehr gemeinsam von der Umwelt mit (“Guck mal, der Wauwau”). Kommuniziert und interagiert mit dem Kind, übersetzt Gefühle (“Ah, das ist also niesen”), Wahrnehmungen werden bestätigt (“Ja, das ein Hund und keine Katze”).
Für mich war das 2004 der entscheidende Grund, mir einen sündteuren Bugaboo zu kaufen, damals noch total neu (das hatte also wenig mit Hipsterkram zu tun, beeile ich mich dann immer zu versichern), der hatte das und fast kein anderes Modell.
Wenn ich jetzt an spätestens jeder Fußgängerampel auf meinem Händi herumscrolle, kriege ich also weniger von meinem Baby mit und wir bekommen weniger miteinander vom Drumrum mit. Ohne Wertung und ohne Einteilung in Grade von “schlimm”: Das ist erstmal nur eine Beschreibung dessen, was da geschieht.
Thomas Harms zeigte auf diesem Kongress in der vorletzten Woche (in ganz anderem Kontext zu der von ihm aus der Reich´schen Körpertherapie entwickelten Emotionellen Ersten Hilfe ) ein ganz berühmtes Video, das berühmte Still-Face-Experiment. Schauen wir einmal, was es mit einem Baby macht, wenn Mamas Gesicht zwar weiterhin sichtbar für das Baby ist, aber plötzlich keine mimische Interaktion mit ihrem Baby zeigt:
In der ersten Phase des Experimentes erlebt das Baby seine Mutter so, wie wir intuitiv mit Babys interagieren. Wir ahmen unsere Babys nach, verändern unsere Stimmfarbe, wiederholen gewisse kleine Abschnitte und Phrasen. Gern übertreiben wir da ein bisschen. Das typische Babyduziduzi eben. Auf dass auf jeden Fall die Message beim Baby ankommt: Ich bin für Dich da. Ich sehe Dich.
Fehlt das nun plötzlich, ist das Baby zunächst irritiert. Kommt nach einigen hilflosen Versuchen noch immer kein Response, wird aus der Irritation Ängstlichkeit und Verstörung.
Und nun schauen wir uns einfach das an, was wir aus der Bindungsforschung vorangegangener Jahrzehnte wissen und übertragen es auf unsere moderne Lebenswelt „mit Händi“. Wir versetzen uns also in ein Baby, das mit einer Mama (oder mit seinem Papa) kommunizieren möchte, die oder der gerade eine wichtige Mail liest. Oder im Internet nach der bestgeranktesten Milchpumpe recherchiert. Oder eine Instastory hochlädt.
Wie nimmt ein Baby wohl das mimische Agieren der Bindungsperson wahr? Wie sieht das wohl von außen aus, wenn der Blick in dieser Weise auf ein anderes Objekt gerichtet wird, das der Erwachsene offenbar gebannt, interessiert, absorbiert (und für das Baby oft gar nicht sichtbar, das ist der Unterschied zum konzentrierten Staubsaugen oder Suppe kochen) anschaut?
Mama/ Papa bekommt erst nach einer Weile überhaupt mit, dass mein Baby irgendwas doof findet, murmelt beim ersten Herumknötern vielleicht noch etwas von “ja, gleich Schatz”, während er/ sie aber weiter aufs Händi schaut – das Baby hat gar keine Chance, zu wissen, wer wann womit gemeint ist, weil es auch sein könnte, dass ich gerade eine Sprachnachricht verschicke oder meiner Insta-Community ein herzliches “Guten Morgen” zukommen lasse. Ohne Blickkontakt – keine Botschaft, so ist das bei Babys.
Alternativ können wir es auch übertragen auf unsere Erwachsenenleben. Wir kennen es alle oder könne es uns vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn wir miteinander am Tisch oder auf dem Sofa sitzen und das Gegenüber permanent auf unseren diversen Kanälen Nachrichten, Mails und Feeds checkt, kaum, dass man mal eine kurze Gesprächspause riskiert. Las ich auch, ohne Quellenangabe: Ein Handy lenkt mehr ab als eine Zeitung. Unter hinter der kann man sich immerhin verstecken.
Oder wie es sich zum Beispiel für größere Kinder (etwa meine) anfühlt, wenn man zwischendurch immer mal ein „doch, doch, ich hör Dir zu“ vom Sofa murmelt. Mir gehen jedenfalls ziemlich schnell die Argumente aus, wenn ich mich dann beim nächsten Ping aus dem Teenie-Klassenchat, mitten im Gespräch, so einen Satz sagen höre wie: “Kannst Du nicht einmal das Händi liegenlassen, während ich mit Dir spreche?”.
Ein Baby kann vor allem nicht angemessen protestieren im Sinne von: „Sag mal geht´s noch, ich rede mit Dir!“ Was eigentlich – zumindest in einigen Situationen – die einzig passende Entgegnung wäre (und wie es meine Kinder tun und was der Grund für so manch handfeste Ehekrise sein dürfte).
Mehr möchte ich hier auch eigentlich gar nicht sagen oder “aus Fachsicht” dazu erklären. Weil es ganz schnell wieder in Mombashing ausartet (oder wie das heißt) und schlechtem Gewissen in unserem Muttersein. Weil es zum Beispiel auch immer eine Frage des Maßes ist. Nur stelle ich genau zur Frage des “Maßes” fest (und suchtähnliches Verhalten zeichnet sich genau dadurch aus), dass wir auch schnell dazu neigen, unser eigenes Verhalten herunterzuspielen, zu relativieren und mit dem “machen alle/ wahlweise: so ist das halt heutzutage, schon immer hat man über “neumodische Gefahren” gewettert”-Totschlagargument wegzureden.
Geschehen ist genau das zum Beispiel überwiegend in dem Artikel in der FAZ, in dem sich die Autorin lediglich “einen Moment lang schuldig” fühlt. Ich mag den den Artikel, schmunzle wegen der nicen Beobachtungsgabe, der leisen Ironie, gute Schreibe, und finde ihn aber in dem Moment an doof, wo es auf der Ebene “Ich kann bisher bei meinen Kindern keinen Schaden feststellen” was für mich nur eine ziemlich schlichte und beängstigend unreflektierte Variante von “Hat uns auch nicht geschadet” ist. Uns allen sollte klar sein, dass wir manchmal Süchtige sind, die bisweilen vollkommen unreflektiert wie ein Pawlowsches Tier auf das „Message-Ping“ reagieren, als gäbe es kein “Später”.
In meinem Buch gibts ja auch ein kurzes Kapitel, das “Multimedia im Wochenbett” heißt. Seitens des Verlages ist deutlich kürzer und auch inhaltlich vorsichtiger ausgefallen ist, als ich das geplant hatte (gut, das ganze Buch ist um ca 100 Buchseiten kürzer ausgefallen, noch dicker wäre eben auch nicht gegangen ;P).
Mein Verlag empfand es als “inhaltlich zu kontrovers”, diese erste (deutschsprachige) größere Studie zu diesem Thema zu zitieren, deshalb fehlt sie im Quellenteil. Und das empfinde ich als eigentliches Problem daran: Es gibt Themen, die sind wohl hauptsächlich deshalb kontrovers, weil sie uns emotional betreffen. Weil wir uns in unserer Mutterqualität oder der Intensität an Mutterliebe gemessen und bewertet fühlen. Und wenn es dann Themen gibt, wo die Studienlage Konsequenzen ausmacht (gestillte Kinder haben gesundheitliche Benefits verglichen mit nicht-gestillten, Kinder, die im Kleinkindalter viel oder sehr früh – was “viel oder früh” ist, steht in der Studie – mit digitalen Medien konfrontiert sind, zeigen häufiger Auffälligkeiten im kognitiven oder sozial-interaktiven Bereich), wollen wir das, wenn wir und unsere Kinder im “Betroffenencluster” zu finden sind, irgendwie nicht so gern hören.
Und dann hält man lieber die Klappe, um auf Facebook keinen shitstorm zu riskieren.
Hier verlinke ich sie mal, die BLIKK-Studie. Es geht im Wesentlichen um größere Kinder, aber am Rand eben auch um Babys und deren Eltern. Wer keine 147 Seiten lesen möchte, findet hier dazu den Kurzbericht des Bundesgesundheitsministeriums in Gestalt der, Achtung, Drogenbeauftragten. Darin auch die Kennzahlen, die derzeit die Empfehlungen zum Medienkosum von Kindern beinhalten (empfohlene Bildschirmzeit für Kinder unter 3 Jahren: Null Minuten/ Tag, zum Beispiel).
Und weil ich Hebamme bin, die ja grundsätzlich (Klischeeschublade auf) keine Gelegenheit auslässt, mal wieder die gute alte Zeit, Waldorf und Langzeitstillen zu propagieren, lasse ich es mal dabei. Denn: Nachdenken und bewerten, was das für Euch, in Eurem Leben heißt – könnt Ihr alle selbst.
Und, Disclaimer: Ja, ich mache das auch, am Händi rumscrollen, und manchmal auch ohne Anlass und zu oft auch mitten in “Quality-Time-Momenten” mit meinen Kindern. Manchmal „muss“ ich das vielleicht auch. Manchmal muss ich aber auch nicht, und mache es trotzdem. Weil es mir Zerstreuung ist, Ablenkung, Fun. Ich bin Mensch, Mutter und unperfekt in fast allen denkbaren Dingen. Und bin im übrigen in weiten Teilen einigermaßen froh, im 21. Jahrhundert angekommen zu sein. Aber in Bezug auf mein Smartphone und den landläufigen Umgang damit meistens mit der Ahnung, dass das irgendwie oft einfach nicht gut ist. Und mit dem unbedingten Willen, Ahnungen Ernst zu nehmen und im Wissen, dass das allerbeste Argument für mehr Digital Detox im Leben vor meinen Augen stattfindet: das Leben mit meinen Aufmerksamkeit aufsaugenden Kindern.
(Fotocredit: herzlichen Dank an Okka Rohd)
Magazin . Das Leben | Mama | Wochenbett
Kate im Wochenbett oder: Wie zerrüttet muss man aussehen nach einer Geburt?
Anlässlich der Geburt von Royal Baby Nummer drei, Prinz Louis Arthur Charles, habe ich in der letzten Woche in der Dienstagssprechstunde auf Instagram über die ambulante Geburt gesprochen. Im Allgemeinen und im Speziellen. Ich mag es natürlich immer sehr, wenn Themen, an denen mein Hebammenherz hängt, durch Menschen, die eine große öffentliche Wahrnehmung haben, transportiert werden, weil sie dann ein Stückchen weiter im allgemeinen Bewusstsein ankommen und nehme das sehr gern als Aufhänger. Und als anglophile Frau habe ich natürlich eine gewisse Beziehung zum englischen Königshaus, aber das ist ein anderes Thema.
VON Kareen Dannhauer


In dem Fall ging es mir im Wesentlichen darum, nochmal einige Worte darüber zu verlieren, dass man nach einer Geburt nicht etwa als alleinig richtigem oder gar sicheren Ort in einem Krankenhaus aufgehoben sein muss, sondern das Wochenbett von Beginn an zu Hause verbringen kann, und was es da so an Punkten zu bedenken und vorzubereiten gibt.
Was bei öffentlichen Personen (die an diesem Punkt mein vollstes Mitleid haben, denn sie gehören nicht zu denen, die ihr Privatestes freiwillig öffentlich machen und via Instagram oder anderen sozialen Medien schon erste Ultraschallbilder, erste Wehen und erste Muttertränen teilen) nun die unausweichliche Begleitmusik ist, sind öffentliche Kommentare. Zu allem, auf Schritt und Tritt. Und bei Frauen geht es dann ziemlich schnell um Äußerlichkeiten. Die dann keine sind, dazu komme ich gleich.
Schon bei der Vorankündigung des Themas der Live-Sprechstunde erreichten mich auf Instagram mehrere Anregungen, ich möge doch auch mal bitte was zu Kate sagen. Also dazu, wie sie aussieht. Welches Körperbild da so transportiert würde. Was das mit uns “normalen Frauen” macht.
Daraufhin sah ich mir die kurzen Bilder, die Kate beim Verlassen der Klinik zeigten, noch einmal ganz genau an. Und sah: Nichts, was ich als “Show”, als “Augen zu und denk an England” oder Ähnliches identifizieren würde.
Ich sah eine strahlende junge Frau, die glücklich und sicher noch etwa wackelig auf den Beinen ihr frisch geborenes Baby zum wartenden Auto trug, eine Strecke von etwa zehn Metern und fünf Treppenstufen.
Strahlend. Glücklich, es geschafft zu haben. Ein bisschen stolz. Sicher auch erschöpft.
Was mich dann irritierte und was sicher auch der Hintergrund einiger der Nachfragen war: Dieses Bild wurde nicht geglaubt. Kann ja gar nicht sein, dass man aussieht wie das blühende Leben, nach so einer Geburt. Das ist doch nicht die Wirklichkeit. Typisch Promi. Typisch Scheinrealität. Wo ist die Erschöpfung, die Zerstörtheit?
Und das ist für mich Problem Nummer eins: Das öffentliche Bild von “Geburt” rangiert irgendwo in den Kategorien “schrecklich” und “hoffentlich schnell vorbei”. Dass sich eine Geburt eben genau durch die Gleichzeitigkeit von eigentlich (oder sonst im Leben) oft unvereinbaren Gegensätzen auszeichnet, ist erstmal merkwürdig und ungewohnt, aber eben auch sehr sehr typisch. Es ist schmerzhaft und gleichzeitig “wow”. Es scheint unschaffbar und ist es gleichzeitig doch. Gebären ist beyond.
Ganz klar ist: Gebären ist eine Grenzerfahrung, möglicherweise auch eine Zumutung. Jeder, der eine Geburt erlebt hat, weiß das. Welche Gestalt dieses zunächst leblose Wort dann hatte und welch existenzielle Formen es anzunehmen vermag, gehört zu den Dingen, die man sich vor einer Geburt wohl tatsächlich schwerlich vorstellen kann, hier habe ich schon einmal darüber geschrieben. Und zudem ist Gebären eine ausgesprochen unterschiedliche Erfahrung. Weil Geburten unterschiedlich sind. Und die Erschöpfung danach, die liegt in den ersten Lebensstunden häufig unter einem Endorphinhigh verborgen.
“Frauen können gebären” heißt eben auch: Es zerstört sie nicht zwangsläufig.
In dem Fall ging es mir im Wesentlichen darum, nochmal einige Worte darüber zu verlieren, dass man nach einer Geburt nicht etwa als alleinig richtigem oder gar sicheren Ort in einem Krankenhaus aufgehoben sein muss, sondern das Wochenbett von Beginn an zu Hause verbringen kann, und was es da so an Punkten zu bedenken und vorzubereiten gibt.
Was bei öffentlichen Personen (die an diesem Punkt mein vollstes Mitleid haben, denn sie gehören nicht zu denen, die ihr Privatestes freiwillig öffentlich machen und via Instagram oder anderen sozialen Medien schon erste Ultraschallbilder, erste Wehen und erste Muttertränen teilen) nun die unausweichliche Begleitmusik ist, sind öffentliche Kommentare. Zu allem, auf Schritt und Tritt. Und bei Frauen geht es dann ziemlich schnell um Äußerlichkeiten. Die dann keine sind, dazu komme ich gleich.
Schon bei der Vorankündigung des Themas der Live-Sprechstunde erreichten mich auf Instagram mehrere Anregungen, ich möge doch auch mal bitte was zu Kate sagen. Also dazu, wie sie aussieht. Welches Körperbild da so transportiert würde. Was das mit uns “normalen Frauen” macht.
Daraufhin sah ich mir die kurzen Bilder, die Kate beim Verlassen der Klinik zeigten, noch einmal ganz genau an. Und sah: Nichts, was ich als “Show”, als “Augen zu und denk an England” oder Ähnliches identifizieren würde.
Ich sah eine strahlende junge Frau, die glücklich und sicher noch etwa wackelig auf den Beinen ihr frisch geborenes Baby zum wartenden Auto trug, eine Strecke von etwa zehn Metern und fünf Treppenstufen.
Strahlend. Glücklich, es geschafft zu haben. Ein bisschen stolz. Sicher auch erschöpft.
Was mich dann irritierte und was sicher auch der Hintergrund einiger der Nachfragen war: Dieses Bild wurde nicht geglaubt. Kann ja gar nicht sein, dass man aussieht wie das blühende Leben, nach so einer Geburt. Das ist doch nicht die Wirklichkeit. Typisch Promi. Typisch Scheinrealität. Wo ist die Erschöpfung, die Zerstörtheit?
Und das ist für mich Problem Nummer eins: Das öffentliche Bild von “Geburt” rangiert irgendwo in den Kategorien “schrecklich” und “hoffentlich schnell vorbei”. Dass sich eine Geburt eben genau durch die Gleichzeitigkeit von eigentlich (oder sonst im Leben) oft unvereinbaren Gegensätzen auszeichnet, ist erstmal merkwürdig und ungewohnt, aber eben auch sehr sehr typisch. Es ist schmerzhaft und gleichzeitig “wow”. Es scheint unschaffbar und ist es gleichzeitig doch. Gebären ist beyond.
Ganz klar ist: Gebären ist eine Grenzerfahrung, möglicherweise auch eine Zumutung. Jeder, der eine Geburt erlebt hat, weiß das. Welche Gestalt dieses zunächst leblose Wort dann hatte und welch existenzielle Formen es anzunehmen vermag, gehört zu den Dingen, die man sich vor einer Geburt wohl tatsächlich schwerlich vorstellen kann, hier habe ich schon einmal darüber geschrieben. Und zudem ist Gebären eine ausgesprochen unterschiedliche Erfahrung. Weil Geburten unterschiedlich sind. Und die Erschöpfung danach, die liegt in den ersten Lebensstunden häufig unter einem Endorphinhigh verborgen.
Magazin . Das Leben | Familie | Mama | Papa | Schwangerschaft | Wochenbett
Woran erkenne ich ein gutes Nahrungsergänzungs-mittel?
Ihr fragt mich häufig nach „guten Nahrungsergänzungsmitteln“, kurz „NEM“, und weil ich hier nicht permanent „Werbung unbezahlt“ hinschreiben will kommen hier ein paar Kriterien für deine Auswahl. Daran erkennst du ein gutes Nahrungsergänzungsmittel:
VON Kareen Dannhauer


01
Made in Germany
Wenn du sicher sein möchtest, dass die strengen gesetzlichen Richtlinien, etwa zu Inhaltsstoffen und Dosierungen, die in Deutschland gelten, eingehalten werden, solltest du einen Hersteller wählen, der seine Ware in Deutschland produziert und aus Deutschland verschickt. Viele Produkte, die aus dem Ausland versandt werden, sind hierzulande schlicht nicht verkehrsfähig und dürfen daher gar nicht in Deutschland verkauft werden.
02
Natürlich natürlich?
Besonders „bio“ oder „natürlich“? Kommt besonders gut an und sieht auch schicker aus auf Instagram, so ein fancy Superfood-Extrakt aus fernen Ländern. Die Dosis konkreter Vitamine aus einem Pflanzenextrakt ist für ein NEM aber schwierig umzusetzen oder sogar gar nicht erlaubt (weil natürliche Stoffe nie standardisierte Mengen eines Wirkstoffes enthalten, das aber im Rahmen der Verkehrsfähigkeit eine Rolle spielt). Vor allem geht „natürlich“ meist zulasten der Bioverfügbarkeit, weil die „aktivierten“ Verbindungen aus dem Labor weniger von den komplexen Umbauprozessen in deinem Stoffwechsel benötigen. Und man benötigt auch viel größere Mengen, etwa „8 Kapseln für den Tagesbedarf“. Wenn da „aus Gojibeerenextrakt“ steht – iss lieber die Gojibeere selbst (die heimische Blaubeere tuts auch).
03
Bioverfügbarkeit
Bestimmt ist dies das Kriterium, das du ohne fachliches Hintergrundwissen am wenigsten einschätzen kannst. Das kann man aber nicht in einem einzelnen Post erklären. Ein bisschen mehr findest du auch in diesem (älteren) Blogartikel.
04
Wirkangaben
Am liebsten würde man natürlich auf seinen Kapseln lesen, dass diese „auch richtig was bringen“ und „wofür die genau sind“. Allerdings wären das Wirkaussagen mit gesundheitlichem Bezug, und die sind in Deutschland bei NEM verboten! Die einzige Ausnahme sind die so genannten, eng definierten Healthclaims, das sind die etwas geschraubten Formulierungen wie „Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei“. Je zurückhaltender die Formulierungen sind, umso ernster nehmen die Hersteller die Gesetzeslage.
05
Preis
Gute Zutaten in der entsprechenden Qualität sind nicht billig, Wirkstoffe in guter Bioverfügbarkeit kosten oft ein Vielfaches (etwa CoQ10: Ubiquinol kostet mindestens das Doppelte oder Dreifache wie Ubiquinon). Dennoch fallen die Preise der unterschiedlichen Präparate extrem auseinander. Schau auf den Preis der gesamten Tagesdosis, von manchen Produkten benötigst du für die vorgesehene Tagesdosis eine, von anderen zwei oder mehr pro Tag.
06
Baukasten statt Wunderpille
Wenn du dir einen individuellen Nährstoffplan zusammenstellst, landest du vermutlich bei einer Art „Baukasten“,den du dir ganz nach deinen Bedürfnissen und Gesundheitsthemen (etwa deiner Ernährungsform, deinem Alter, deiner medizinischen Vorgeschichte) individuell zusammenstellen kannst. Es wird also eher ein kleines Sammelsurium unterschiedlicher Präparate sein, zum Beispiel ein Multi, dazu Vitamin D (je nach Laborwert), Omega3 und ein Probiotikum. Es gibt diese Baukästen auch schon fertig zusammengestellt, meist sind das die qualitativ hochwertigeren Produkte, die eben auch etwas teurer sind. Auch wenn es convenient erscheinen mag: In eine einzige Pille passen die benötigten Supplemente meist schon quantitativ nicht hinein.
Wenn du deine Produkte im Internet kaufst (was natürlich total in Ordnung ist), vergewissere dich der Seriosität des Herstellers. Schaue unbedingt ins Impressum, welches Unternehmen und welche Menschen dahinterstecken, und gern auch, was die Geschäftsführer noch so machen. Sind da fachlich kompetente Leute am Werk (findest du überhaupt Informationen dazu?) oder eher solche, die in erster Linie auf ein schnell skalierendes Online-Business aus sind?
Es ist relativ einfach, mit einem gewissen Invest bei den großen Verkaufsplattformen mit einem neuen Hipster-Produkt sehr schnell auf den ersten Plätzen gerankt zu werden, spezialisierte Agenturen machen den ganzen Tag nichts anderes. Ein hübsches Design, ein knackiges Storytelling dahinter, ein paar Domains mit „Informationsportalen“ gekauft, einen Online-Kurs dazu und einen großen Schwung 5-Sterne-Bewertungen – fertig ist das Geschäftsmodell.
Welche konkreten Produkte das zum Beispiel sein können? In diesem Blogartikel findest du Empfehlungen von mir, die du dir einfach in deinen Warenkorb klicken kannst:
Magazin . Das Leben | Familie | Mama | Papa
Mikronährstoffe für dein Immunsystem
Überall sind Viren unterwegs – von Influenza über Corona bis hin zu den kleinen Rhinoviren. Husten, Niesen und Schnupfen gehören für viele dazu. Die gute Nachricht: Du kannst dein Immunsystem aktiv unterstützen.
VON Kareen Dannhauer


Vorab: Es ist in Wirklichkeit viel komplizierter, als es hier in einem Blogartikel darstellbar ist. Um ein wenig davon überhaupt zu verstehen, warum bestimmte Mikronährstoffe, etwa Vitamine, Mineralstoffe oder Bioflavonoide, hilfreich sein können, ein ganz paar rudimentäre Basics zum Thema “Immunsystem”.
Das Immunsystem
Dein Immunsystem setzt sich aus vielen unterschiedlichen Kompetenzen deines Körpers zusammen.
Sehr vereinfacht: Es gibt zunächst einmal die zelluläre Abwehr (das sind zum Beispiel die so genannten T-Zellen, eine Unterart der weißen Blutkörperchen, die T-Lymphozyten) und die humorale Abwehr (das ist “der Teil mit den Antikörpern”). Dein Immunsystem ist ein massgeschneidertes, komplexes System, das fortwährend in Deinem Körper Großartiges leistet.
Das kann er aber nur dann, wenn all diese komplexen Kaskaden in deinem Körper auch richtig gut ablaufen können und dazu alle Baustoffe, Katalysatoren und Co-Faktoren in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.
Im Zuge der engagierten Forschung der weltweiten Wissenschaftscommunity – etwa am Beispiel des SARS-Corona-Virus-2 – wird vielleicht auch klar, dass das Immunsystem so komplex ist, dass noch nichtmal absolute Experten alle Details – was genau es mit unserem Körper macht und wie das Immunsystem darauf reagiert – besonders gut oder gar vollständig verstehen.
Warum erkranken einige wenige Menschen – zum Beispiel an Corona – schwer, andere nur ganz leicht oder entwickeln sogar überhaupt keine Symptome? Warum stecken sich einige Menschen offenbar leichter an als andere? Neben genetischen Variablen, die mehr oder weniger fancy sind (es werden etwa die Zugehörigkeit zu bestimmten Blutgruppen und ethnische Komponenten diskutiert, es gibt einen Zusammenhang mit genetisch bedingten Autoantikörpern gegen Interferone und etliche Thesen mehr) ist unser Immunsystem durch individuelle Bedingungen ganz unterschiedlich aufgestellt. Dazu gehört unser Alter und unsere körperliche Verfassung im Allgemeinen genau so, wie etwa die Jahreszeit, Umweltfaktoren, aber natürlich reihenweise individuelle Dinge wie etwa epigenetische Faktoren und letztlich natürlich auch die Versorgung mit bestimmten Nährstoffen.
Diese individuelle Konstellation macht entscheidende Unterschiede aus. Es ist immer eben auch das “Milieu” für die Erkrankung und deren Verlauf entscheidend, nicht allein der Erreger – und viele, viele unbekannte und im Einzelfall manchmal auch tückische Faktoren.
Es kommt also auch darauf an, auf welchen Boden das Virus fällt, und wie kompetent sich der Körper mit eben jenem Erreger erfolgreich auseinandersetzen kann. Nur weiß man einige davon eben auch nicht zwangsläufig vorher.
Gerade das, was Viren in der so genannten postakuten Phasen nach unterschiedlichen Latenzphasen in unserem Körper machen, ist auch bei Viren, die wir schon länger kennen, nicht wirklich gut verstanden. Dazu gehört Multiple Sklerose nach einer Epstein-Barr-Viruserkrankung, Gebärmutterhalskrebs nach HPV oder die tödliche Panenzaphalitis nach Masern. ME/CFS ist eine zunehmend bekanntere, schwere neurologische-immunologische Erkrankungen, die von etlichen Viren ausgelöst werden kann und die im Zuge des Post- oder Long-Covid-Syndroms eine wichtige Rolle spielt.
Schutz in der Virenhölle
In diesem Text geht es vorrangig um Erwachsene und um die Frage, welche Nahrungsergänzungsmittel sie unterstützend nehmen können.
Kleine Kinder sind am Lebensanfang dabei, ihr Immunsystem reifen zu lassen. Erwiesenermaßen hilft dabei im wesentlichen das (längere) Stillen durch die Weitergabe von Immunglobilinen und probiotischen Bakterien und der Aufenthalt draußen (Tageslicht, Temperaturreize, Kontakt zu Bakterien, frische Luft) bei jedem Wetter.
Ein Kind braucht kein “Training” für sein Immunsystem durch Krankheit, gleichwohl tragen (unvermeidliche) Infekte dazu bei, im Laufe der Kindheitsjahre nach und nach ein gewisses Immungedächtnis aufzubauen. Impfungen sind ein weiterer Baustein für dieses Immungedächtnis. Gegen Erkrankungen, die – mehr als andere – mit Risiken eines schweren Verlaufs oder post-akuten Folgen verbunden sind, impft man heutzutage. Relevant für das Immunsystem in all diesen Fällen ist die “Information”, also der Antigen-Kontakt, nicht die Krankheit.
Auch die Corona- und Influenza-Impfung ist für kleine Kinder zugelassen, steht aber nicht für alle Kinder im STIKO-Kalender. Gegen RSV gibt es bislang noch keine Impfung, vermutlich wird sie aber in den nächsten wenigen Jahren zugelassen.
Je kleiner Kinder sind, umso anfälliger sind sie für einige Viren, die ihnen vor allem im Babyalter sehr zu schaffen machen können und auch Krankenhausaufenthalte nicht selten sind. Influenza oder RSV gehört dazu, auch eine Covid-Erkrankungen in den ersten Lebenswochen ist oft nicht ohne. Babys gilt es also zu schützen, hier gilt der Leitsatz: Je kleiner, umso wichtiger ist das.
In schlimmen Infektwintern kann es daher durchaus eine Überlegung wert sein, ein größeres Geschwisterkind phasenweise nicht in die Kita zu schicken. 2021 war eine intensive RSV-Saison plus Covid, auch 2022 scheint wieder ein ausgesprochen infektreicher Winter zu werden.
Es gibt ein paar (mittlerweile pandemiebedingt bekannte) Basics, die nicht primär “das Immunsystem stärken”, sondern die Virendichte vermindern, eine weitere wichtige Säule, um Infekte zu vermindern oder “milder” verlaufen zu lassen. Es ist eben nicht egal, “wie viel Virus” auf unsere Schleimhäute trifft.
Hier sind an erster Stelle die gute Qualität der Atemluft in Innenräumen zu nennen, die sich zum Beispiel mithilfe von Luftfiltern signifikant verbessern lässt. Es gibt welche, die für den privaten Gebrauch gut geeignet, effizient und erschwinglich sind, ich habe beispielsweise diesen hier von Philips. Noch kleinere, mobile Luftfilter können in bestimmten Innenraum-Situationen als Add-On ebenfalls eine gute Idee sein, etwa für Schulkinder, auf Flügen oder in Restaurants. Ich habe zwei toGo-Filter, sie sind etwa so klein wie ein Thermobecher und passen in jede Tasche oder Schultisch.
Auch wenn einzelne Familienmitglieder erkrankt sind, können Luftfilter im Krankenzimmer eine gute Idee sein. Bei manchen Viren ist es auch eine Überlegung wert, ob Ihr ggf. Isolationsmaßnahmen ergreifen möchtet (oder könnt), damit sich nicht alle Familienmitglieder anstecken. Erwachsenen fällt das naturgemäß leichter. Ihr werdet es möglicherweise sehr zu schätzen wissen, wenn nicht alle Care-Personen gleichzeitig mit Influenza oder Covid flachliegen. Auch dann, wenn Ihr etwa bis zum Moment eines positiven Schnelltests (zB bei Corona) Tisch, Bett und alles andere eben noch geteilt habt, ist es eben nicht “jetzt sowieso egal”! Je länger und umso häufiger Ihr Viruskontakt habt, umso wahrscheinlicher ist die Gefahr der Ansteckung, vielleicht seid Ihr also nochmal davongekommen und könnt Euch für die nächsten Tage noch schützen.
Und Masken helfen nicht nur als Schutz gegen Corona, sondern mindestens genau so gut gegen Influenza und RSV.
Auch in einer kleinen Wohnung müssen sich mit ein paar Schutzmaßnahmen also nicht zwangsläufig alle Familienmitglieder gegenseitig anstecken, natürlich abhängig von der immer komplett individuell zusammengewürfelten Situation. Ein Baby oder Kleinkind kann sich natürlich nicht isolieren, ist gleichzeitig aber auch ein vulnerabler Kandidat und sollte sich in den ersten Lebenswochen oder -monaten wirklich nicht unbedingt mit RSV, Influenza oder Covid anstecken.
Die für Erwachsene weithin unterschätzten Faktoren, die die Resilienz deines Körpers beeinflussen und Dein Immunsystem stärken, sind die Dinge, die schon Oma wusste, und die erstmal sehr banal klingen: Ruhe, Schlaf, Bewegung, Licht und frische Luft – und zum Aufwärmen gern ne gute Hühnersuppe (nicht umsonst im amerikanischen Sprachraum auch “Jewish Penicillin” genannt). Diese einfachen Dinge helfen Deinem Körper für ein intaktes Immunsystem, um sich nicht beim ersten Virus gleich umhusten zu lassen, und, im Erkrankungsfall, sich im Rahmen seiner gesunden Regulationskapazität mit dem Erreger auseinanderzusetzen und schnell wieder zu genesen.
Tatsächlich schwächt kaum etwas das Immunsystem so sehr wie Schlafmangel, zum Thema Schlaf und Melatonin folgt gleich unten noch etwas mehr.
Nahrungsergänzung
Vitamin D ersetzt keine Corona-Impfung und eine Influenza-Infektion lässt sich nicht wesentlich von heißem Ingwer-Tee beeindrucken. Es gibt aber Supplements, von denen Dein Immunsystem profitieren kann, sie sind weder besonders originell noch neu. Mittlerweile gibt es auf diesem Gebiet eine Vielzahl von Metananlysen und klinische Beobachtungsstudien, eine kleine Auswahl davon findest du unten bei den Quellen.
Vitamin D
Vitamin D ist eines der wichtigsten Vitamine für Dein Immunsystem. Die Schwere vieler respiratorische Virusinfektion (etwa Influenza, und auch Covid) korrelierten direkt mit dem Vitamin-D-Spiegel im Serum der Patient_innen. Ein Vitamin-D-Mangel durch ein unzureichende Versorgung (Serumwerte unter 30 ng/ml) erhöht die Infektanfälligkeit für Atemwegsinfektionen deutlich, diese Zusammenhänge sind auch schon lange bekannt.
In der Corona-Pandemie gab es viele Hinweise in klinischen Untersuchungen und Fallanalysen, dass Menschen mit schweren Covid19-Verläufen häufiger einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel aufweisen, als Patient_innen mit milderen Verläufen, es fanden sich auch Beobachtungen, dass mit Hochdosen behandelte Patient_innen weniger oft eine intensivmedizinische Therapie oder eine invasive Beatmung benötigen. Zudem findet man eine weitere interessante Korrelation: Auch die Suszeptibilität sinkt mit höherem Serum-Spiegel, Menschen mit einer guten Vitamin-D-Versorgung stecken sich offenbar deutlich seltener überhaupt mit dem Coronavirus an.
Vor allem am Ende des Winters haben nahezu alle Menschen auf der Nordhalbkugel einen serologischen Vitamin-D-Mangel – es ist also zwischen Oktober und April (auch unabhängig vom Coronavirus) ausgesprochen sinnvoll, Vitamin D zu supplementieren. Unten findest du eine einfache Formel zur Dosierung in der Zusammenfassung.
Das Mama Vitamin D3 + K2 besteht aus nur drei natürlichen Inhaltsstoffen im optimalen Verhältnis zueinander: Vitamin D3, dem Co-Faktor Vitamin K2 MK7 all-trans und zertifiziertem Bio-MCT-Öl. Das enthaltene MCT-Öl aus der Kokosnuss begünstigt eine besonders hohe Bioverfügbarkeit und eine sehr gute Aufnahme durch den Körper.
Vitamin A
Viel weniger bekannt, aber genau so wichtig und ein Synergent von Vitamin D, ist ein weiteres fettlösliches Vitamin, das – wie Vitamin D ebenfalls hormonartig wirkt: Vitamin A. Beide Vitamine wirken effektiv an epigenetischen Schaltern und haben vielfältige Wirkungen auf das Immunsystem. Speziell für die Schleimhaut-Immunität der Atemwege (aber auch des Darmes, Stichwort T-Zellen-Bildung in den Peyer´schen Plaques) ist Vitamin A zentral bedeutsam. Vitamin A spielt darüber hinaus auch eine wichtige Rolle bei der Regulation der T-Zellen. Es steigert die Immuntoleranz und reduziert die überschießende Entzündungsantwort der Immunsystems, ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei einem schweren Covid19-Verlauf.
In der Schwangerschaft wird oft vor Vitamin A gewarnt, gleichzeitig besteht in der Schwangerschaft – wie bei fast allen anderen Vitalstoffen auch – ein erhöhter Bedarf an Vitamin A, dieser wird (etwa in den DACH Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr) mit ca. 3.500 IE/ d angegeben. In hohen Dosen (ab etwa 10.000 IE, regelmäßig) kann es teratogen (embryotoxisch) wirken.
Diese landläufige Warnung hat zur Folge, dass Schwangere sich kaum noch trauen, gelegentlich in ein Leberwurstbrot zu beißen (gehört übrigens zu den eher häufigen Schwangerschaftsgelüsten). So gehören Schwangere tendenziell zu den Vitamin-A-Mangelkandidaten. Leber ist bekanntermaßen eine herausragende Vitamin-A-Quelle (danach kommt erstmal lange nichts), aber eben auch Geschmackssache.
Die Aufnahme über Beta-Carotin, eine Vorstufe, kann tatsächlich nicht (wie oft behauptet) “einfach mal so” zu Vitamin A umgebaut werden: Der genetischen Polymorphismus des Betakarotin spaltenden Enzyms (BCMO) ist tatsächlich weit verbreitet, fast die Hälfte der weißen Europäer ist davon betroffen. Übersetzt: Viele Menschen können Beta-Carotin nur sehr ungenügend zu Vitamin A umbauen. Wichtig ist dies vor allem für vegan oder vegetarisch lebenden Menschen, diese sollten “echtes Vitamin A, also Retinol, supplementieren.
Alle into life Produkte enthalten Vitamin A nur in der “echten” Retinol-Form, natürlich in schwangerschaftskompatiblen Menge, etwa im Mama Multi und im Mama immun. Auch in der Kombination beider Produkte bist Du noch weit im absolut schwangerschaftssicheren Mengenbereich!
Beide Vitamine, A und D, modulieren das Immunsystem, sorgen also dafür, dass die Prozesse im Rahmen der Pathophysiologie so ablaufen, wie es sich für eine gut bekämpfte Virusinfektion im Körper gehört – das Immunsystem also keine zu schwache, aber eben auch keine überschießende Immunreaktion (bei Covid zum Beispiel der gefürchtete Cytokinsturm) zeigt.
Das MAMA MULTI: unser Rundum-Sorglos Multivitamin- und Spurenelement-Präparat speziell für die Bedürfnisse in Schwangerschaft und Stillzeit. Eine Kapsel deckt deinen Bedarf an allen Vitaminen und Spurenelementen als optimale Basisversorgung.
Zink & Vitamin C
Ein vielkombiniertes und weithin bekanntes Dreamteam in Sachen Abwehrsteigerung kennst Du sicher von jeder banalen Erkältung: Zink plus C.
Zink ist (so man das in der Komplexität essentieller Stoffe überhaupt so sagen kann) wohl das wichtigste Spurenelement für das Immunsystem im Allgemeinen und die Wehrhaftigkeit gegen Viren im Speziellen, und es dafür bei Erkältungs- und Influenzaviren gut beforscht. Zink steigert sowohl die zelluläre als auch humorale Immunabwehr und hat zudem eine direkte antivirale Wirkung an der Oberfläche von Viren. Es hemmt die Virusvermehrung und das Anheften des Virus an die Rezeptoren auf den Schleimhäuten, über die das Virus in die Zelle eindringt. Außerdem hat es eine wichtige Funktion im Vitamin-A-Stoffwechsel.
Vitamin C ist wohl das bekannteste Abwehr-Vitamin und hat eine herausragende Bedeutung für die adaptive und erworbene Immunität. Auf humoraler Ebene unterstützt Vitamin C die Antikörperproduktion, zudem wirkt es anti-entzündlich. Klinische Studien der ersten Coronawelle in Wuhan zeigten schon früh, dass eine Hochdosisbehandlung mit Vitamin-C-Infusionen die Beatmungsdauer bei schwer erkrankten Covid19-Patient*innen verkürzen kann sowie die Komplikationsraten und die Mortalität signifikant reduziert.
Zink & C sind sowohl systematisch wirksam (also über die Blutbahn), als auch lokal an den Schleimhäuten im direkten Viruskontakt. Dafür eigenen sich Lutschtabletten wie diese oder ein Granulat (schmeckt wie Brausepulver), etwa das hier, sie sind auch für Kinder geeignet.
Omega 3
Auch die Wirkung von Omega 3 auf das Immunsystem ist vielfach belegt. Omega-3-Fettsäuren wirken antientzündlich und auf die Viskosität der roten Blutkörperchen und damit auf die Durchblutung und Sauerstoffversorgung feiner, zarter Gewebe mit ihren Kapillargefäßen. Omega 3 wirkt positiv auch auf die Zellen des Endothels, die Auskleidung unserer Blutgefäße. Diese können nach schweren viralen Infektionen angegriffen sein und zu Komplikationen wie “Micro-Clotting” (winzige Blutgerinnsel) führen, nach SARS-CoV-2 bekannt im Rahmen einer möglichen Ätiologie des Long-Covid-Syndroms.
Ein im Omega 3 enthaltener Lipidmediator, das Protektion D1, scheint zudem die Virusreplikation abzuschwächen, auch das ist schon länger bekannt und im Zusammenhang mit Influenzaviren untersucht.
Omega 3 wirkt zudem immunmodulatorisch, anti-inflammatorisch und hat positive Wirkungen auf die Darmschleimhaut und das Mikrobiom des Darms. Gute Idee also zur Ergänzung deines Speiseplanes, eigentlich immer und für jede_n, auch für Kinder.
MAMA OMEGA 3 besteht aus qualitativ hochwertigem pflanzlichen Algenöl. Es zeichnet sich durch ein besonders günstiges DHA:EPA-Verhältnis von 2:1 aus und ist somit ein optimaler Omega-3-Lieferant für die Kinderwunschzeit, Schwangerschaft und Stillzeit.
Gurgeln?
Hilft Gurgeln mit antiviralen Substanzen gegen das Virus? Daten zeigen, dass Gurgeln tatsächlich die Viruslast herabsetzt und bei Coronainfektionen die Dauer der Virusausscheidung (gemessen an positiven Schnelltests) verringert – aber das heißt natürlich nicht, dass man sich eine bereits stattgehabte Infektion “weggurgeln” kann. Ist das Virus erst mal in die Rachenschleimhautzelle eingedrungen, vermehrt es es sich fleißig im Inneren der Zelle. Dort ist es einem Antiseptikum außen auf der Schleimhaut gar nicht mehr zugänglich.
Als Expositionsprophylaxe oder auch täglichen Routine ist es aber eine weitere Maßnahme, die du ergreifen kannst.
Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat verschiedene Studien zur Prä- und Postexpositionsprophylaxe ausgewertet und in einer kleinen deutschsprachigen Übersicht mit wirkungsvollen Handlungsoptionen zusammengestellt, du findest sie unten bei den Quellen.
Wenn man etwa mit anderen Familienangehörigen zusammenlebt und diese vor einer Ansteckung in der heimischen Isolation etwas besser schützen möchte, kann das in jedem Fall eine gute, ergänzende Idee sein. Amüsanterweise schnitten in einer Untersuchung mit verschiedenen Substanzen erfrischend banale herkömmliche Mundwasser (mit) am besten ab: Zum Beispiel das unspektakuläre Listerine Cool Mint.
Du kannst dir angewöhnen, damit zu gurgeln, nachdem du Viren ausgesetzt warst (abends beim nachbauest kommen) oder es sonstwie eine deine Bad-Routine integrieren.
Nasenspray
Auch Nasenspray kann ein Baustein der Expositionsprophylaxe sein, auch diese wurden von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene angeschaut. Das Nasenepithel ist die erste Barriere, auf die ein respiratorisches Virus trifft.
Dort kommen dann auch die IG-A-Antikörper ins Spiel, unsere so genannte “Schleimhautabwehr”. Eine gut befeuchtete Schleimhaut mit wachen Flimmerhärchen ist eine stabilere erste Phalanx, die es für alle Viren erstmal zu überwinden gilt. Nasenspray hilft, sie zu befeuchten, einige Inhaltsstoffe können die lokale Abwehr noch unterstützen. Zink ist eine Möglichkeit, auch lokal hat es einen Einfluss, wie auch beim Lutsch-Granulat, siehe oben. Ein Nasenspray, das neben befeuchtenden und pflegenden Substanzen Zink enthält, ist dieses. Eine weitere Substanz ist Xylit, auch das unterstützt die lokale Infektabwehr, ein Nasenspray dazu ist das hier. Du kannst es ausgiebig mehrfach täglich anwenden.
Nachgewiesen antivitale Wirkung hat auch Carragelose, es bildet einen gewissen Schutzfilm auf der Schleimhaut, hemmt die Virusreplikation und verkürzt statistisch die Virus-ausscheidenden Tage bei einer Corona-Infektion, Algovir ist eine Möglichkeit. Ich habe in jeder Tasche eins, meine Kinder auch, und ich wende es mehrfach täglich an, etwa wenn ich in die U-Bahn steige oder sonstige Menschenmengen betrete.
Ganz neu auf dem Markt ist VirX enovid auf der Basis von Zitronensäure und Stickstoffmonoxid, welches das Eindringen des Virus in die menschliche Zelle verhindern kann. Effizient, leider etwas teurer, und es brennt etwas, daher finde ich es für (kleine) Kinder nicht so gut geeignet.
Auch der in antiallergischen Nasensprays enthaltene Wirkstoff Azelastin kann die Vermehrung der Corona-Viren wirksam hindern. Dabei wirkt Azelastin einmal direkt an der Hauptprotease von Sars-CoV-2. Diese ist wichtig für die Virusvermehrung. Azelastin zeigt zudem auch Wirkung am ACE2- und Sigma-1-Rezeptoren – diese Strukturen der Wirtszelle nutzt Sars-CoV-2 für den Viruseintritt und die Vermehrung.
Am Abend befreit eine Nasendusche effektiv Feinstaub und auch Bakterien und reinigt so die Nase und hilft den Schleimhäuten, gut zu funktionieren. Wichtig: Nur mit einer 1%-2% Salzlösung spülen, niemals mit purem Leitungswasser. Dazu eignet sich banales Kochsalz, mische 200 ml mit 2 g Salz.
Benutze abgekochtes Wasser und reinige dein Nasenspülkännchen regelmäßig. Ich finde, das geht mit Porzellankännchen wie diesem besser als mit denen aus Plastik (und schöner sind sie auch).
Für Babys eignen sich Spritzen mit einem weichen Silikonaufsatz, diese lassen sich auch viel besser reinigen als die Gummi-Ohrspritzen.
Weitere Pharmanutricals wie Ingwer, Echinacin, Propolis und Co
Jede Familie hat so ihre eigene Hausapotheke und alles, was du darin findest, worauf du schon immer schwörst im Falle eines viralen Infektes (Erkältungen und grippale Infekte sind sämtlich virale Infekte – so grundsätzlich unterscheidet sich das Coronavirus davon nicht) – ist willkommen. Ingwer, Curcumin in der Golden Milk, und andere unspezifische naturheilkundlich bekannte Pflanzen und Wirkstoffe, wie Echinacea oder Propolis, rein damit, was auch immer du da so magst und bevorzugst.
Bioflavonoide: Quercetin
Auch Quercitin, ein neongelbes Polyphenol und Flavonoid, ist ein weiterer spannender Wirkstoff aus Pflanzen. Er kommt zum Beispiel in Kapern und Liebstöckel in relevanten Mengen vor. Quercetin hat anti-inflammatorische und antivirale Wirkungen. Zusammen mit Vitamin C und L-Gluthation bildet es ein Redox-System (antioxidant) und synergiert mit ihnen zu einem Wirkkomplex, besonders gut wirkt Quercetin also zusammen mit Vitamin C.
500 mg am Tag können eine gute Ergänzung sein. In unserem neuen Mama immun ist Quercetin natürlich auch enthalten.
Schlaf und Melatonin
Schlaf ist enorm wichtig für unser Immunsystem, umgekehrt gibt es wenig, was so sehr unser Immunsystem und seine Fähigkeit, sich gegen Erkrankungen zu wehren, sabotiert, wie Schlafmangel. Sorge also dafür, dass Du ausreichend schläfst. In der Zeit mit kleinen Kindern ist das leichter gesagt als getan, das einzige Zeitfenster, das dafür halbwegs funktioniert, ist meist der frühe Abend: geh regelmäßig mit den Kindern ins Bett, um ein paar Stunden aufzuholen.
Eine wesentliche Rolle für die erholsame Funktion des Schlafes spielt das Melatonin. Das ist ein in der Zirbeldrüse produziertes Hormon, das wir tagaktive Menschen in der Nacht ausschütten. Es ist eines der wichtigsten Hormone für unseren zirkadianen Rhythmus und es sorgt dafür, dass unser Gehirn in der Nacht runterfährt und Reparaturfunktionen im Körper wirksam werden können. Melatonin schützt die Blut-Hirnschranke und hat enorm potente antioxidative Effekte.
Melatonin ist seit einiger Zeit auch als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Es ist auch in der Schwangerschaft gut untersucht. Es gilt sogar als neuroprotektiv für das fetale Gehirn und wird bei drohenden Frühgeburten für diesen Effekt über die Gabe an die Mütter gelegentlich aktiv eingesetzt. Eine Anwendung gilt also als absolut sicher.
Gut vorsorgen
- Hilf deinem Immunsystem, damit es dich gut schützen kann: Schlafe genug, bewege dich an der frischen Luft und setze dich Temperaturreizen aus. Iss gesund und nährstoffreich.
- Überlege, inwieweit du deine Virenexpositionen in saisonalen oder pandemiebedingten Wellen reduzieren kannst und möchtest. Masken helfen, Luftfilter auch.
- Überlege, dich saisonal gegen Influenza u/o SARS-CoV-2 impfen zu lassen, sprich dazu mit deiner Ärztin.
- Weil ein Infekt ja immer dann kommt, wenn es am wenigsten gut passt und irgendwie immer Wochenende ist: Sei vorbereitet und habe ein paar Dinge im Haus. Sollte zum Beispiel im Fall einer Covid-Infektion auch eine Isolation im Spiel sein und Du das Haus nicht verlassen können, gehört auch ein Account von Lebensmittelbringdiensten, Lieferando und Co dazu (sowieso eine gute Idee für belastete Zeiten & junge Eltern).
Wenn du dein Immunsystem gezielt mit Nahrungsergänzung unterstützen möchtest, supplementiere zusätzlich ein paar Immunbooster:
-
- Ein vollständiges, hochwertiges Multivitaminpräparat, zum Beispiel unser Mama Multi. Hierin ist schonmal eine Basisversorgung an allen relevanten Vitaminen und Spurenelementen in moderater, natürlich schwangerschaftskompatibler Dosierung enthalten.
- Vitamin D: Im Winter solltest du Vitamin D supplementären, als Richtgröße gelten etwa 40 – 60 IE/ kg Körpergewicht/ Tag. Insgesamt sind das für erwachsene Personen so zwischen 3.000 – 4.000 IE, gut dosierbar über Tropfen mit dem Co-Faktor Vitamin K, etwa in unserem Mama Vitamin D3 + K2 (für Babys das Baby Vitamin D)
In infektreichen Zeiten sind weitere “Immun-Nährstoffe” nochmal eine zusätzliche Ergänzung wert.
- In unserem neuen Produkt Mama immun haben wir die Stars unter den immunprotektiv wirkenden Vitalstoffen kombiniert, eine Lösung für alle, die nicht viel nachlesen möchten oder verschiedene Einzelmittel kombinieren.
→ Du kannst Mama immun individuell ergänzen. Eine “volle Tagesdosis” sind 6 Kapseln, etwa dann, wenn du eine Erkältung herankommen spürst oder dich gerade nach einem Virusinfekt erholst. In geringer Dosierung, etwa 2-4 Kapseln, kannst du es vorsorglich nehmen. Folgende Vitalstoffe sind besonders wichtig:
- Vitamin C: in jeglicher Form, per buntem Obstteller (Orangen, Kiwi, Paprika)
Mama immun (6 Kapseln) enthält 1,8 g Vitamin C als PurewayC®
- Zink: Wer Austern mag, ist klar im Vorteil, zwei davon decken deinen kompletten Tagesbedarf. Auch in Fleisch ist reichlich Zink enthalten. Zink gehört damit zu den potentiellen Mangelspurenelementen bei vegetarischer oder veganer Ernährung, dann solltest du supplementieren.
Mama immun (6 Kapseln) enthält 25 mg Zink als Zink-Bisglycinat
- Alternativ oder zusätzlich: C plus Zink als Lutschtabletten oder Brausepulver
- Vitamin A: Man kann selbstgemachte Leberpastete nach dem Rezept der ostpreußischen Oma essen. Wenn du vegan oder vegetarisch lebst, kannst du Vitamin A natürlich auch supplementieren. Schwangere sollten hier aufpassen, Eine Obergrenze für eine sichere Dosis liegt bei etwa 10.000 IE/ d, der Tagesbedarf bei etwa 3.500 IE/ d.
Mama immun (6 Kapseln) enthält 667 IE Vitamin A (= 200 µg), das Mama Multi nochmal 667 IE, auch die Kombi ist also absolut safe
- Omega 3: 400 mg DHA/ EPA sind eine gute Basisversorgung, enthalten in ca 45 Trpf. von unserem Mama Omega 3, auch für Kinder natürlich gut geeignet.
Angesteckt!
Natürlich sind Infekte unvermeidlich – und wenn es dich erwischt hat, weiß ja jeder intuitiv, was gut tut:
- Gesundes Krankheitsverhalten ausleben: Alles absagen, Telefon ausstellen, Sofa, Wolldecke, Buch, Bett. Kinderbetreuung organisieren (der schwerste Teil daran, ich weiß …).
- Schlafen, ruhen, viel trinken (Faustregel: pro Grad erhöhte Körpertemperatur – 1 Liter zusätzlich).
- Bei ersten Erkältungssymptomen (nicht mehr im fortgeschrittenen Stadium und auch nicht mit Fieber!): ein ansteigendes Bad nehmen. Bei gemütlicher Temperatur in die Badewanne, heißes Wasser zulaufen lassen (bis “richtig heiß”). Danach ins Bett und nachruhen, im besten Fall einschlafen. In der Schwangerschaft: bade nicht zu heiß, bleibe unter 40 Grad Wassertemperatur.
- Fieber senken? NSAR (nicht-steroidale Anti-Rheumatika) wie Ibuprofen und Paracetamol wirken fiebersenkend und schmerzlindernd. Fieber ist gleichzeitig eine gesunde Immunreaktion und per se nicht “schlimm”. Es kurbelt zudem die Antikörperproduktion an. Es hängt also an dem individuellen Leidensdruck: Wenn das Fieber dir den Schlaf raubt oder du berstende Kopf- und Gliederschmerzen hast, ist Ibuprofen (max. 1.800 mg/d) das Mittel der Wahl, im letzten Drittel der Schwangerschaft ist Ibuprofen kontraindiziert und du musst auf Paracetamol ausweichen! Was jedoch in keinem Fall passieren soll: Fiebersenker einwerfen, um “weiter im Text” zu machen, dein Körper braucht unbedingt Ruhe und Schonung, auch, um schwereren Verläufen und postviralen Komplikationen vorzubeugen.
- Hühnersuppe schlürfen, ansonsten Essen nur nach Appetit. Viele virale Infekte machen Appetitlosigkeit, und auch leichten Magen-Darm-Symptome, wie latente Übelkeit, häufiges Aufstoßen, vor allem Kinder übergeben sich auch oft im Frühstadium einer Erkrankung), das ist ok!
- Nasenspray: bei potentiell bösen Viren wie Covid oder Influenza kannst du 3x täglich VirX-Nasenpray in beide Nasenlöcher sprühen (oben näher erklärt).
- Vitamin D-Shot: Wenn Du nicht schwanger bist und in den letzten Wochen nicht (oder nur wenig) supplementiert hast, können auch kurzzeitige höhere Dosierung (ggf. in Absprache mit Deiner Ärztin) 1x tgl. 20.000 IE für die Dauer des Infektes sinnvoll sein.
Wenn es dich erwischt hat, kannst du jetzt dein Mama immun wunderbar auf die volle Dosis – 6 Kapseln pro Tag – aufstocken.
- Vitamin C: eher gramm- als milligrammweise, in jeder Form von Zitronen- oder Orangensaft, Kiwi, Paprika, Brokkoli bis Ascorbinsäure (1/4 TL/ d).
In 6 Kps. Mama immun sind 1,8 g enthalten.
- Zink: Du kannst im Infekt bis insgesamt ca 50 mg/ d ergänzen, bis zum Bessern der Symptome.
In 6 Kps. Mama immun sind 25 mg enthalten
- C plus Zink lokal, zum Beispiel als Lutschtabletten oder Brausepulver (s. o.) können auch eine gute Option oder Ergänzung sein und wirken zudem lokal an den Rachenschleimhäuten.
- mehr Omega 3, etwa 1.00 mg sind eine gute Dosis.
- Quercetin: Das neongelbe Anivirus-Flavonoid verleiht unserem Mama immun sowohl Farbe als auch den Extra Immun-Kick: In 6 Kps. Mama immun sind 400 mg enthalten
- Melatonin scheint die Blut-Hirnschranke zu schützen. Wie oben beschrieben, ist die Funktion des Schlafes essentiell für unser Immunsystem. Wenn du nicht gut schlafen kannst (oder das vorher bereits ahnst), kannst du Melatonin supplementären: 2 mg am Abend direkt vor dem Schlafengehen (2 mg = 2.000µg) unter die Zunge sprühen, gibt es in jeder Drogerie. Schau auf die enthaltene Menge. Melatonin wirkt nur über die Mundschleimhaut, nicht über den Magen-Darmtrakt (etwa über Tees oÄ)!
Quellen
Prothrombotic autoantibodies in serum from patients hospitalized with COVID-19; Yu Zuo et al.; Science Translational Medicine 02 Nov 2020; DOI: 10.1126/scitranslmed.abd3876
Empfehlung der DGKH: Prävention von COVID-19 durch viruzides Gurgeln und viruziden Nasenspray – aktualisierte Fassung Februar 2022
COVID-19: Azelastine nasal spray Reduces Virus-load In Nasal swabs (CARVIN). Early intervention with azelastine nasal sprays reduces viral load in SARS-CoV-2 infected patients. First report on a double-blind placebo-controlled phase II clinical trial.
SARS-CoV-2 accelerated clearance using a novel nitric oxide nasal spray (NONS) treatment: A randomized trial
Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study; Marta Entrenas Castillo et al. J Steroid Biochem Mol Biol 2020 Oct;203:105751.doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105751
Nitric Oxide Nasal Spray (NONS) as Prevention for Treatment of Individuals at Risk of Exposure to COVID-19 Infection
Synergistic Effect of Quercetin and Vitamin C Against COVID-19: Is a Possible Guard for Front Liners.
25-Hydroxyvitamin D Concentrations Are Lower in Patients with Positive PCR for SARS-CoV-2; Antonio D’Avolio et al.; Nutrients 2020 May 9;12(5):1359. doi: 10.3390/nu12051359.
Selenium Deficiency Is Associated with Mortality Risk from COVID-19; Arash Moghaddam et al., Nutrients. 2020 Jul; 12(7): 2098; doi: 10.3390/nu12072098
Prediction of survival odds in COVID-19 by zinc, age and selenoprotein P as composite biomarker; Raban Arved Heller 1 Redox Biol 2020 Oct 20;38:101764. doi: 10.1016/j.redox.2020.101764
Early Nutritional Interventions with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19; Jan Alexander 1et al.; Nutrients 2020 Aug 7;12(8):2358. doi: 10.3390/nu12082358.
Vitamin C may reduce the duration of mechanical ventilation in critically ill patients: a meta-regression analysis; Harri Hemilä, Elizabeth Chalker; Intensive Care. 2020 Feb;8:15. doi: 10.1186/s40560-020-0432-y.
May omega-3 fatty acid dietary supplementation help reduce severe complications in Covid-19 patients? Pierre Weill et al.; Biochimie 2020 Sep 10;S0300-9084(20)30209-1. doi: 10.1016/j.biochi.2020.09.003.
The lipid mediator protectin D1 inhibits influenza virus replication and improves severe influenza
Immunrelevante Mikronährstoffe bei viralen Atemwegsinfektionen; Uwe Gröber, Peter Holzhauer, Klaus Kisters; Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2020; 52: 51–56 DOI https://doi.org/10.1055/a-1162-2469
Virucidal Efficacy of Different Oral Rinses Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2; Toni Luise Meister et al. The Journal of Infectious Diseases, Volume 222, Issue 8, 15 October 2020, Pages 1289–1292, https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa471
 Kinderwunsch
Kinderwunsch Schwangerschaft
Schwangerschaft Geburt
Geburt Wochenbett
Wochenbett Stillzeit
Stillzeit Baby
Baby Mama
Mama Papa
Papa Longevity
Longevity




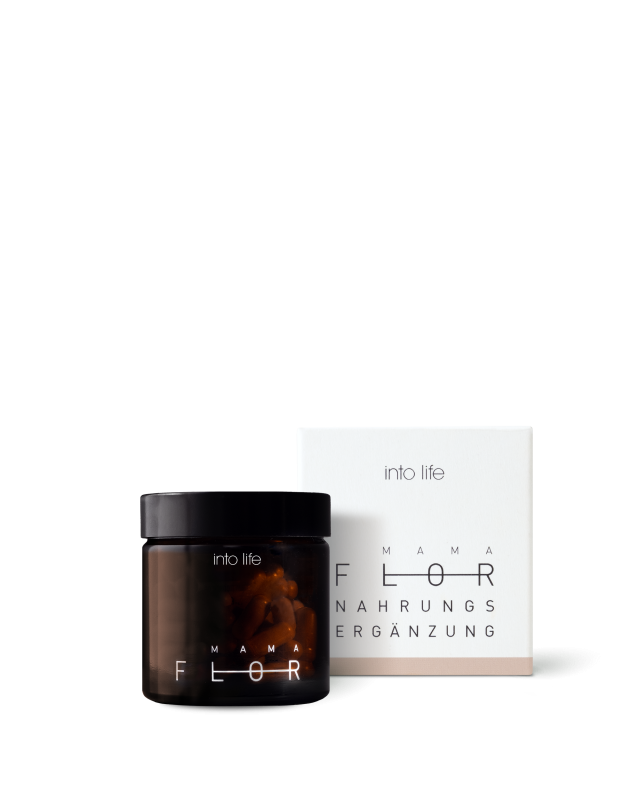






 Warum Kreatin für Schwangere eine gute Idee ist
Warum Kreatin für Schwangere eine gute Idee ist Kinderwunsch? Das kannst du beachten
Kinderwunsch? Das kannst du beachten Unsere Entstehungsgeschichte
Unsere Entstehungsgeschichte